6 Minuten
Raumfahrt-Sehrisiken und ein neues Vorhersagewerkzeug
Die Raumfahrt stellt den menschlichen Körper vor vielfältige physiologische Herausforderungen, wobei die Augen besonders empfindlich sind. Ein Krankheitsbild, das als spaceflight associated neuro-ocular syndrome (SANS) bezeichnet wird, führt bei einem relevanten Anteil der Astronautinnen und Astronauten nach längeren Missionen zu fortschreitenden Sehstörungen. Manche Defizite bessern sich nach der Rückkehr zur Erde wieder, andere bleiben jedoch bestehen oder zeigen nur eine partielle Erholung. Deshalb ist die frühzeitige Identifikation von Besatzungsmitgliedern mit erhöhtem Risiko entscheidend für die Sicherheit und die Planbarkeit von Langzeitmissionen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of California, San Diego haben ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Screening-Verfahren entwickelt, das vor dem Start vorhersagen soll, welche Raumfahrer wahrscheinlich SANS entwickeln werden. Das Modell wertet präfligtliche Augenaufnahmen aus und erkennt strukturelle Muster, die bislang erst nach der Exposition gegenüber Mikrogravitation sichtbar wurden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, individuelle Risikoprofile zu erstellen und präventive Maßnahmen gezielter einzusetzen.
Studienaufbau, Datenbasis und KI-Strategie
Die Forschenden trainierten ein Deep-Learning-Modell auf einer begrenzten, jedoch sorgfältig kuratierten Datenbasis von okulären Bildgebungen. Da echte Astronautinnen- und Astronauten-Scans naturgemäß selten sind, ergänzten die Forschenden die Daten mit Bildern aus terrestrischen Mikrogravitäts-Simulationen sowie mit klinischen Augenuntersuchungen von Personen, die nie im All waren. Diese Kombination erhöhte die Variabilität und half, domänenspezifische Merkmale zu identifizieren, die mit SANS assoziiert sind.
Um die Zahl der Trainingsbeispiele weiter zu erhöhen, zerlegten die Forschenden jedes volumetrische Augen-Scan in tausende zweidimensionale Schichten. Dieser Ansatz erlaubt dem neuronalen Netzwerk, feingranulare Merkmale über verschiedene Netzhaut-Layer hinweg zu lernen — zum Beispiel subtile Unterschiede in der Dicke der retinalen Nervenfaserschicht (retinal nerve fiber layer, RNFL) oder Veränderungen des retinalen Pigmentepithels (retinal pigment epithelium, RPE). Die Datenvorverarbeitung umfasste standardmäßige Bildnormalisierung, Artefakt-Filterung und Registrierung, um Unterschiede in Aufnahmeparametern zwischen Geräten und Zentren auszugleichen.
Das Training erfolgte auf einem Hochleistungs-Supercomputer der UC San Diego mit GPUs und optimierten Deep-Learning-Frameworks. Zur Verbesserung der Generalisierbarkeit setzten die Forschenden Techniken wie Transfer Learning, Datenaugmentation (Rotationen, Spiegelungen, Kontrastvariationen) und strenge Cross-Validation ein. Zusätzlich wurden Erklärbarkeitsmethoden wie Saliency-Maps und Grad-CAM verwendet, um die Entscheidungsgrundlage des Modells nachvollziehbar zu machen und klinisch relevante Regionen zu identifizieren.
Das Modell lernte, subtile anatomische Veränderungen der Netzhaut — etwa in der RNFL, im RPE und in der makulären Konfiguration — mit einer späteren SANS-Diagnose zu assoziieren. Bei Cross-Validation auf zurückgehaltenen Präflugscans erzielte das System eine Vorhersagegenauigkeit von etwa 82 Prozent. Diese Leistung deutet darauf hin, dass präfligtliche Bildgebung verwertbare Biomarker enthält, die eine Anfälligkeit für mikrogravitationsassoziierte Sehverluste anzeigen können.
Zentrale Ergebnisse und wissenschaftliche Implikationen
Die KI identifizierte nahezu identische Muster von Veränderungen in Augen, die echter Raumfahrt ausgesetzt waren, und in solchen, die in erdbasierten Mikrogravitäts-Analoga beobachtet wurden. Das spricht dafür, dass ähnliche zugrundeliegende Mechanismen — etwa Flüssigkeitsverschiebungen, veränderte intrakranielle Druckverhältnisse und strukturelle Umstrukturierungen der Netzhaut — sowohl im Orbit als auch in Simulationsbedingungen aktiv sind. Diese Parallelen stützen den Einsatz bodengebundener Analoga für die Erforschung der Raumfahrtgesundheit und die Verfeinerung von Screening-Protokollen vor Missionen.

Neben der Vorhersagefunktion liefert das Modell auch Einsichten in die mögliche Pathophysiologie von SANS, indem es jene Retinaregionen hervorhebt, die den größten Einfluss auf die Risikoklassifikation haben. Diese Regionen deuten auf mehrere potenzielle Mechanismen hin: anhaltende Flüssigkeitsverlagerungen Richtung Kopf und Auge, subtile Anstiege des intrakraniellen Drucks und strukturelles Remodeling innerhalb retinaler Schichten. Solche Hinweise sind nicht nur akademisch relevant, sondern haben direkte Bedeutung für die Entwicklung gezielter Gegenmaßnahmen.
Beispielsweise könnten die Erkenntnisse zu einer Optimierung bereits erprobter Gegenmaßnahmen führen — wie etwa der Einsatz von Unterkörper-Negativdrücken, die Flüssigkeitsverschiebungen aus dem Kopfbereich reduzieren, oder die Anpassung von Trainingsprogrammen, um vaskuläre und zerebrovaskuläre Veränderungen zu modulieren. Ebenso denkbar sind verbesserte In-flight-Monitoring-Strategien mit portablen OCT-Systemen (optische Kohärenztomographie) und die Integration optischer Hilfsmittel, die kurzfristige Seheinschränkungen ausgleichen. Langfristig könnte die Kombination aus präfligtlicher Risikoabschätzung und in-flight-Interventionen die Inzidenz schwerwiegender, bleibender Sehschäden deutlich senken.
Die Forschenden betonen jedoch, dass das System noch nicht für den operativen Einsatz zugelassen ist. Vielmehr sehen sie es als Grundlage für eine integrierte Gesundheits-Toolchain für Astronautinnen und Astronauten. Die Implementierung KI-gestützter Präfligt-Screenings in die Missionsplanung könnte personalisierte Präventionsstrategien, eine informierte Besatzungsplanung und Echtzeit-Risikominderung für Langzeitmissionen zum Mond, zum Mars oder zu anderen Zielen des Deep Space erleichtern.
Breiterer Kontext und nächste Schritte
SANS ist nur eines von mehreren Gesundheitsrisiken, die mit längerer Schwerelosigkeit verbunden sind. Weitere bedeutende Probleme sind Knochenmassenverlust, kardiovaskuläre Dekonditionierung, Muskelatrophie sowie neurokognitive Veränderungen. Eine umfassende Risikobewertung für Langzeitmissionen muss all diese Faktoren berücksichtigen und den Nutzen sowie mögliche Nebenwirkungen gegeneinander abwägen. Vor diesem Hintergrund ist die Erweiterung der Trainingsdatenbank ein zentraler nächster Schritt.
Die Robustheit und Generalisierbarkeit des Modells lässt sich durch zusätzliche Astronauten-Scans, multimodale Bildgebung (z. B. Kombination von OCT, Fundusfotografie, MRT und vaskulären Messungen) und längsschnittliche Nachverfolgung deutlich verbessern. Langfristige Studien, die präfligtliche, in-flight- und postfligtliche Messungen verknüpfen, sind erforderlich, um Verlaufsmuster, Zeitpunkt der Ausprägung und mögliche Reversibilität besser zu verstehen. Methodisch ist die Einbeziehung multimodaler Daten auch deshalb vielversprechend, weil strukturelle Bilddaten durch funktionelle oder biosignalbasierte Messgrößen ergänzt werden können — etwa transkranielle Doppler-Ultraschallmessungen, Hirndruckschätzungen oder systemische Biomarker im Blut.
Auf Seiten der KI-Forschung werden zusätzliche Validierungen notwendig sein: externe Testkohorten, unabhängige Multi-Zenter-Studien und robuste Prüfungen auf Bias — beispielsweise hinsichtlich Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft oder der verwendeten Bildgebungshardware. Regulatorisch wird ein solcher Algorithmus klinische Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, einschließlich prospektiver Studien, Nachweis der klinischen Wirksamkeit und einer Bewertung potenzieller Risiken. Hier sind interdisziplinäre Kooperationen zwischen Raumfahrtmedizinern, Ophthalmologen, Datenwissenschaftlern und Regulierungsbehörden unerlässlich.
Außerdem spielt die Erklärbarkeit der Modelle eine gewichtige Rolle für die Akzeptanz in der klinischen Praxis. Klinikerinnen und Kliniker verlangen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen — etwa Heatmaps, die zeigen, welche Netzhautregionen die KI besonders gewichtet hat, oder klar definierte biometrische Parameter, die als potenzielle Risikomarker dienen. Solche Ausgaben erleichtern nicht nur die Validierung durch Experten, sondern ermöglichen auch gezielte Hypothesentests zu Ursachen und Gegenmaßnahmen.
Fazit
Die KI-basierte Analyse präfligtlicher Augen-Scans bietet einen vielversprechenden Ansatz, um Personen zu identifizieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit raumfahrtassoziierte Sehminderungen erleiden könnten. Mit fortlaufender Datensammlung, methodischer Verfeinerung und sorgfältiger Validierung kann ein Vorhersagesystem zu einem praktischen Bestandteil der Astronautengesundheitsplanung werden. Letztlich könnte ein solches Screening dazu beitragen, das Sehvermögen der nächsten Generation von Langzeitraumfahrern besser zu schützen und die Sicherheit und Erfolgschancen künftiger Missionen zum Mond, Mars und darüber hinaus zu verbessern.
Quelle: sciencealert

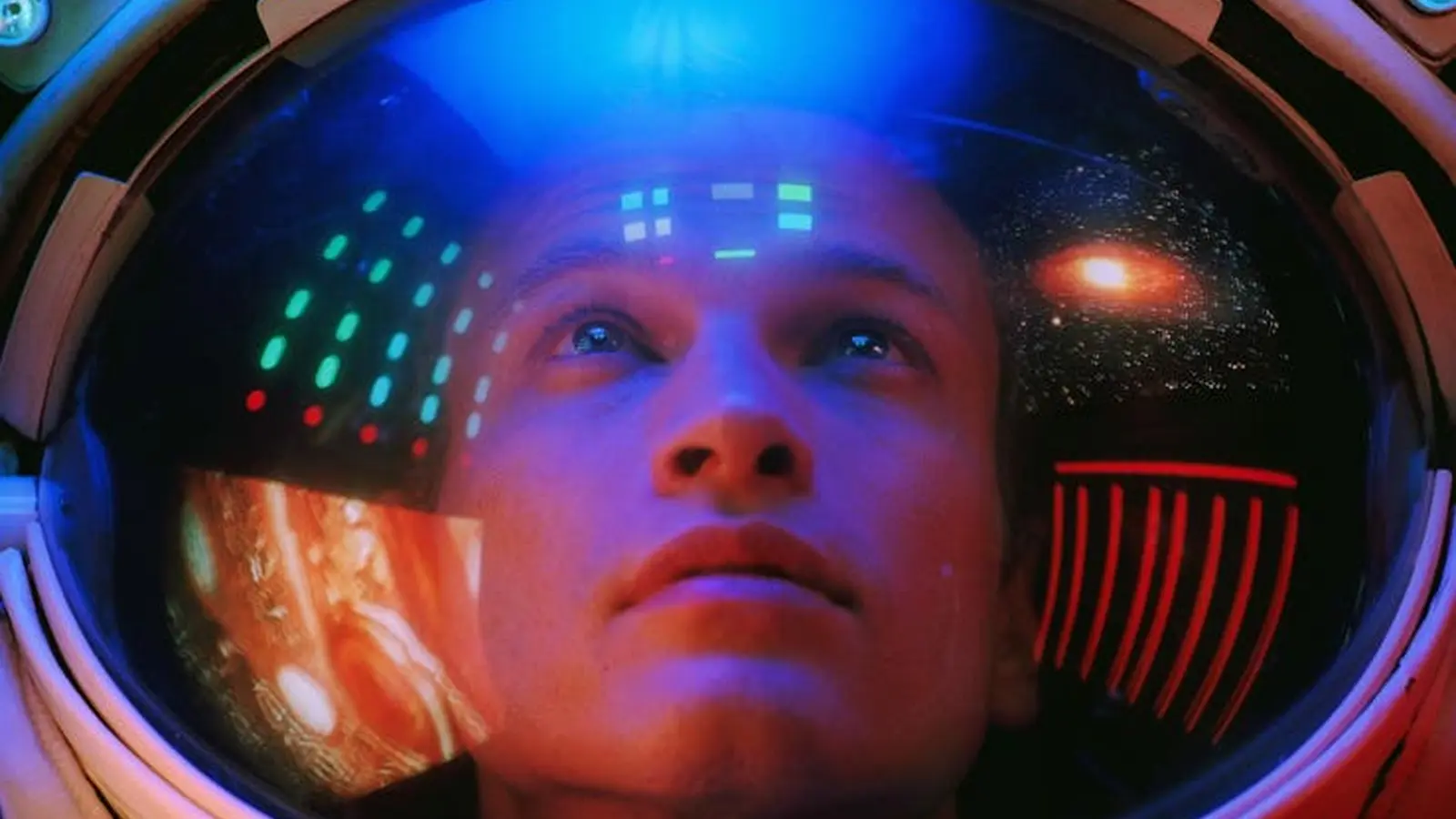
Kommentar hinterlassen