8 Minuten
Neue Erd-System-Modelle zeigen, dass die langfristige Klimaantwort der Erde vielleicht nicht einfach eine ruhige Rückkehr zum Gleichgewicht durch Silikatverwitterung ist. Stattdessen könnte eine starke, ozeanbasierte Rückkopplung — gesteuert durch Nährstoffzufuhr, marine Produktivität, Sauerstoffverlust und Kohlenstoffablagerung — das Klima überkompensieren und über geologische Zeiträume eine anhaltende Abkühlung auslösen, womöglich sogar eine Eiszeit.

Warum die Vorstellung eines einzigen Thermostats nicht mehr ausreicht
Seit Jahrzehnten gilt die Silikatverwitterung als zentraler, langzeitlicher "Thermostat" der Erde. Regenwasser nimmt CO2 aus der Atmosphäre auf, reagiert mit silikatischen Mineralen und transportiert gelöste Karbonate in die Ozeane. Dort werden sie Bestandteil von Muschelschalen, Korallen und karbonathaltigen Sedimenten; im Laufe von Millionen Jahren wird so Kohlenstoff in der Erdkruste gebunden. Diese negative Rückkopplung — wärmere Temperaturen beschleunigen die Verwitterung — stabilisiert die Oberflächentemperatur über geologische Zeitenräume.
Doch die geologischen Aufzeichnungen zeigen Episoden nahezu globaler Vergletscherung, die sich nicht vollständig durch Silikatverwitterung erklären lassen. Forscher wie Dominik Hülse und Timothy Ridgwell haben daher Modelle erweitert, um zusätzliche Prozesse einzubinden — vor allem die Rolle von Phosphor und anderen Nährstoffen in der marinen Biogeochemie. Das Ergebnis: Meeresprozesse können die Kohlenstoffentfernung erheblich verstärken und stärkere Abkühlungen bewirken als bisher angenommen.
Die Mechanik im Ozean: Nährstoffe, Sauerstoffverlust und Kohlenstoff-Bindung
Stellen Sie sich vor, atmosphärisches CO2 steigt und das Klima erwärmt sich. Höhere Temperaturen und intensivere Niederschläge beschleunigen die Verwitterung an Land und erhöhen den Abfluss von Nährstoffen — vor allem Phosphor — in die Meere. Diese Nährstoffzufuhr wirkt wie Dünger für Phytoplankton und andere mikrobielle Produzenten: Ihre Primärproduktion steigt, die biologische Pumpe wird stärker, und mehr organischer Kohlenstoff sinkt in die Tiefsee und wird in Sedimenten beigesetzt.
Das allein ist nicht neu, aber die Modelle zeigen einen entscheidenden sekundären Effekt: Mehr exportiertes organisches Material erhöht die Atmungsraten in suboxischen Wasserschichten und in den Sedimenten. Die Folge ist ein regionaler oder systemweiter Sauerstoffverlust (Ozean‑Deoxygenierung). Niedrigere Sauerstoffgehalte begünstigen Bedingungen, unter denen Phosphor aus Sedimenten leichter remobilisiert und wieder ins Wasser freigesetzt wird. Dieser zurückgewonnene Phosphor wirkt dann wiederum als Dünger — ein positiver Rückkopplungszyklus entsteht: mehr Nährstoffe → mehr Algen → mehr Sauerstoffverbrauch → mehr Nährstoff‑Recycling.
Auf Zeitskalen von Hunderttausenden bis Millionen Jahren kann diese Kettenreaktion die Kohlenstoffablagerung auf dem Meeresboden so stark erhöhen, dass der atmosphärische CO2‑Gehalt weit unter das Niveau sinkt, das allein durch Silikatverwitterung zu erwarten wäre. Die integrierten Erd-System-Modelle von Hülse, Ridgwell und Kollegen demonstrieren, dass eine solche Überkorrektur in einigen Szenarien stark genug sein kann, um eine großräumige Abkühlung und sogar die Auslösung von Glazialphasen zu bewirken.
Wie Phosphor das Spiel verändert
Phosphor ist in der marinen Biogeochemie ein limitierender Faktor: Seine Verfügbarkeit kontrolliert oft das Wachstum mariner Primärproduzenten. Landbasierte Verwitterung liefert Phosphor in löslicher Form, aber ein Großteil dieses Elements bleibt in Küstensedimenten gebunden oder wird auf anderen Wegen entfernt. Modelle mit expliziter Kopplung zwischen sedimentärem Phosphorzyklus und Ozean‑Sauerstoff zeigen: Wird Phosphor häufiger aus Sedimenten zurückgewonnen, erhöht das die produktive Kapazität der Meere über lange Zeiträume. Dieser Prozess kann lokal beginnen, sich aber systemisch ausbreiten, weil die Meere über Strömungen und vertikalen Austausch verbunden sind.
Ozeanische Sauerstoffniveaus: Schwachstelle und Verstärker
Sauerstoffarmut im Ozean verändert nicht nur das marine Leben, sie verändert auch chemische Rückhalte‑ und Freisetzungsprozesse für Nährstoffe. Unter hypoxischen oder anoxischen Bedingungen werden beispielsweise Eisen‑ und Schwefel‑gekoppelte Reaktionen wichtig, die wiederum Phosphor mobilisieren können. Diese biogeochemischen Rückkopplungen sind nicht linear: Kleine Änderungen im organischen Export können bei bereits niedrigem Sauerstoffgehalt große Auswirkungen auf das Nährstoffangebot haben.
Modellfortschritte: Warum neue Simulationen anders reagieren
Die jüngsten Simulationen bauen auf sogenannten prozessreichen Erd‑System‑Modellen auf, die eine explizite Kopplung zwischen sedimentärem Phosphorzyklus, Ozean‑Oxygenierung und globalen Kohlenstoffreservoiren erlauben. Im Unterschied zu älteren, vereinfachten Modellen erlauben diese die Rückführung von Nährstoffen aus Sedimenten als dynamische Variable, die von lokalen Sauerstoffverhältnissen abhängt.
Was diese Modelle besser machen
- Detailliertere Darstellung der Sediment‑Wasser‑Schnittstelle und der Bedingungen für Phosphor‑Remobilisierung.
- Explizite Simulation von Ozean‑Sauerstoffverteilungen und deren Auswirkungen auf Mikro‑ und Makrobelebung.
- Verknüpfung von Küsten‑ und offenen Ozeanprozessen, inklusive Transport und Umverteilung von Nährstoffen.
- Integration von biologischen Rückkopplungen, die Produktivität, Atmung und Sedimentbildung koppeln.
Diese Verbesserungen sind nicht nur numerische Details: sie verändern das qualitative Verhalten des Modells. Während einfache Modelle tendenziell eine glatte Rückkehr zu vorangehenden CO2‑Werten zeigen, können prozessreiche Modelle ein Überschwingen Richtung starker Abkühlung anzeigen — genau weil die Ozeane zusätzliche, verstärkende Hebel besitzen.
Modellunsicherheiten — und warum sie nicht alles erklären
Trotz der Fortschritte bleiben Unsicherheiten bedeutsam. Parameter wie die Empfindlichkeit der Phosphor‑Freisetzung an Sauerstoff, die Effizienz der Kohlenstoffverwitterung an Land und die Rolle kleinräumiger Prozesse (z. B. benthischer Mikroorganismen) sind nicht exakt bekannt. Ebenso hängen die Resultate von Annahmen über vergangene Atmosphären‑Sauerstoffwerte ab. Modelle liefern Szenarien, keine Vorhersagen; sie zeigen, welche Mechanismen möglich sind und unter welchen Bedingungen diese Mechanismen erheblichen Klimaeinfluss ausüben könnten.
Wesentliche Erkenntnisse und Bedeutung für die Zukunft
Aus der neuen Modellarbeit lassen sich zwei miteinander verbundene Einsichten ziehen. Erstens: In der frühen Erdgeschichte, als atmosphärischer Sauerstoff oft niedriger war, konnten Phosphor‑Recycling und sauerstoffarme Ozeane häufiger auftreten. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit starker, nahrstoffgetriebener Rückkopplungen und macht es plausibler, dass extreme Eiszeiten in der geologischen Vergangenheit durch solche Prozesse begünstigt wurden.
Zweitens: Theoretisch könnten langfristig steigende CO2‑Konzentrationen, gefolgt von einer Reihe von Rückkopplungsprozessen, auch heute über sehr lange Zeiträume (Hunderttausende bis Millionen Jahre) vergleichbare Mechanismen in Gang setzen, die Kohlenstoff dauerhaft in Sedimenten binden und so zu einer Abkühlung führen. Praktisch gesehen gibt es jedoch wichtige Einschränkungen:
- Moderne atmosphärische Sauerstoffgehalte sind deutlich höher als während vieler frühe Episoden der Erdgeschichte — das schwächt die Phosphor‑Recycling‑Rückkopplung.
- Die relevanten Prozesse wirken extrem langsam. Selbst wenn sie aktiviert würden, könnten sie die aktuelle anthropogene Erwärmung auf menschlichen Zeitmaßstäben nicht ausgleichen.
- Menschliche Eingriffe in Küstenzonen, Nährstoffeinträge durch Landwirtschaft und Veränderungen mariner Ökosysteme verändern die Ausgangsbedingungen und komplizieren Prognosen weiter.
Wie Timothy Ridgwell betont: Die Frage, wann die Erde natürlich wieder zu einer Vergletscherung zurückkehrt, ist für die unmittelbare Politik zweitrangig. Gesellschaften stehen heute vor konkreten Risiken: Meeresspiegelanstieg, Extremwetter, Biodiversitätsverluste. Auf langsame, gesicherte geologische Mechanismen zu vertrauen, schützt nicht vor diesen unmittelbaren Gefahren.
Was bedeutet das für Klimamodelle und Politik?
Die Erkenntnis, dass Meereschemie und Klima eng gekoppelt sind, verlangt nach einem besseren Einbezug mariner biogeochemischer Prozesse in prognostische Klimamodelle. Für die Politik heißt das: Kurz- bis mittelfristig sollten Emissionsreduktion und Anpassungsstrategien im Vordergrund stehen. Langfristig aber könnten diese Ozean‑Feedbacks die klimatische Ausgangslage verändern — ein Faktor, der für geoökologische Risikobewertungen und die Erforschung langfristiger Klimapfade relevant ist.
Fachliche Einordnung und Expertenstimmen
"Das Modell zeigt, wie eng Ozeanchemie und Klima tatsächlich verbunden sind", sagt Dr. Karen Lopez, Klimasystemwissenschaftlerin (fiktiv). "Es erinnert uns daran, dass Kohlenstoffsenken auf mehreren Zeitskalen wirken und dass Ozeandeoxygenierung Nährstoffhaushalte und damit die Klimawiederherstellung nach einer Erwärmung grundlegend verändern kann."
Solche Stimmen unterstreichen die kombinierte Rolle von Naturprozessen und Modellierung: Nur durch das Zusammenführen geochemischer, biologischer und physikalischer Teilprozesse entsteht ein plausibles Bild, wie das Erdsystem auf Störungen reagieren kann — und welche Überraschungen dabei möglich sind.
Unbequeme Fragen
Welche Regionen des Ozeans sind besonders anfällig für dieses Rückkopplungsverhalten? Küstenregionen mit hohem Sedimenteintrag und eingeschränktem Wasseraustausch gelten als Hotspots, aber auch Teile des offenen Ozeans, wo die biologische Pumpe besonders effizient arbeitet, können eine wichtige Rolle spielen. Wie stark Menschen durch Nährstoffeinträge (z. B. Dünger) lokale Ozeanprozesse bereits verändert haben, bleibt ein aktives Forschungsfeld.
Welche Folgen hätte eine langfristige Abkühlung? Auf geologischen Zeitskalen kann eine Abkühlung Eisbedeckung, Albedo‑Rückkopplungen und großräumige Umverteilung von Niederschlag und Ökosystemen auslösen. Solche Veränderungen würden die Evolution von Lebensgemeinschaften, Sedimentmuster und sogar die Verteilung mineralischer Ressourcen beeinflussen — Prozesse, die über Millionen Jahre sichtbar werden.
Schließlich bleibt die Frage, ob menschliches Handeln die Aktivierung oder Abschwächung solcher Rückkopplungen beeinflussen kann. Direkt steuerbar sind diese geologischen Mechanismen kaum, doch durch Reduktion von Emissionen, Schutz mariner Lebensräume und das Reduzieren von Nährstoffeinträgen in Küstengewässer lassen sich Ausgangsbedingungen beeinflussen — wenn auch nicht in der Geschwindigkeit, die manche erwarten würden.
Insgesamt verdeutlichen die neuen Modelle, dass die Ozeane nicht nur passiv auf das Klima reagieren: Sie sind aktive, langfristig wirkende Akteure im globalen Kohlenstoffkreislauf. Für Wissenschaft, Politik und Gesellschaft bedeutet das eine doppelte Aufgabe: kurzfristig die Erwärmung einzudämmen und langfristig die komplexen, langsam wirkenden Rückkopplungen besser zu verstehen.
Quelle: scitechdaily

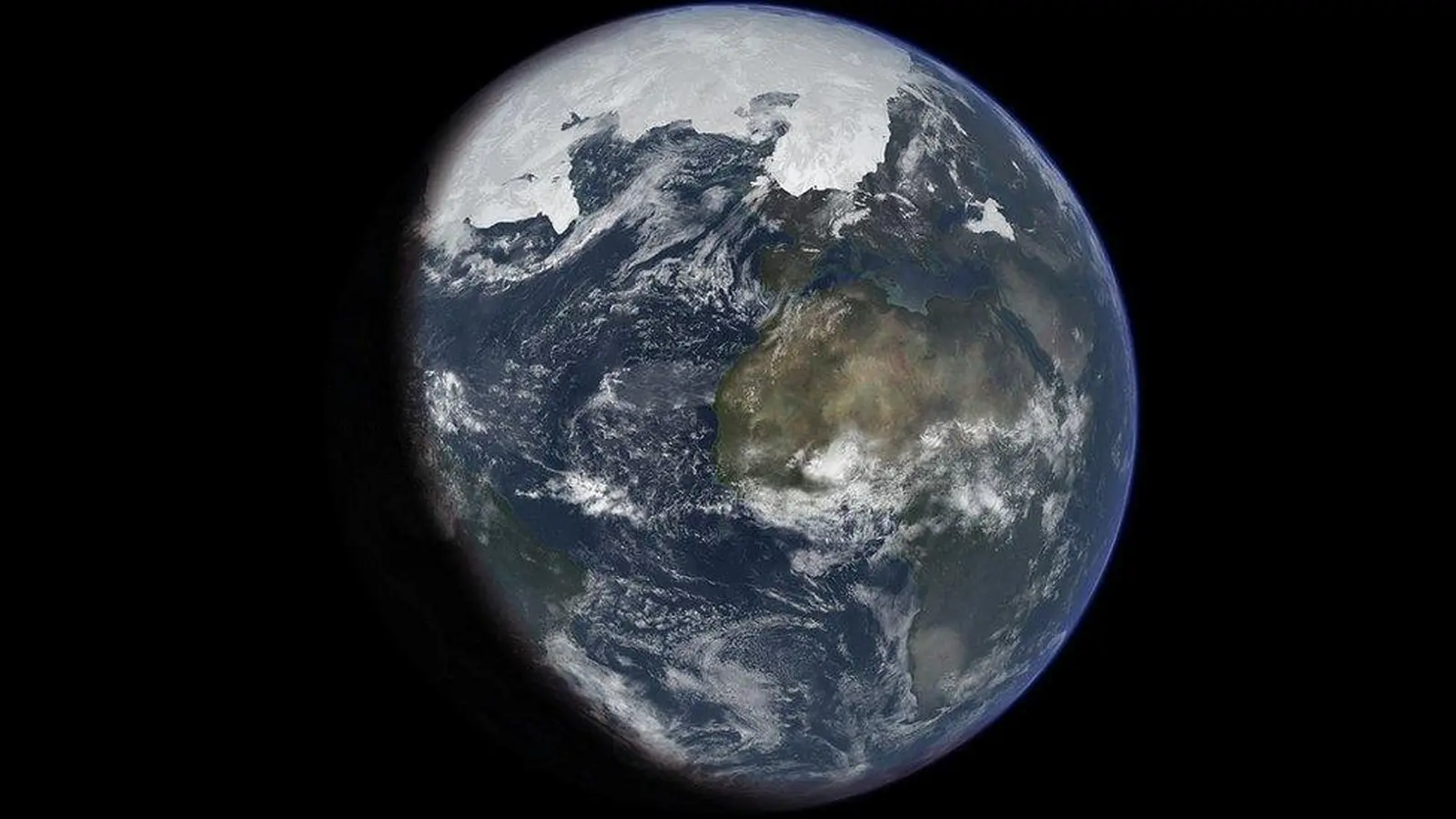
Kommentar hinterlassen