8 Minuten
Robuste neue Forschung zeigt, dass Meeres-Hitzewellen die biologische Kohlenstoffpumpe des Ozeans stören können — jenes System, das Kohlenstoff von der Oberfläche in die Tiefsee transportiert. Ein interdisziplinäres Team unter Leitung des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kombinierte Daten autonomer Messbojen mit langjährigen Schiffserhebungen im Golf von Alaska, um zu untersuchen, wie zwei bedeutende Hitzewellen die Planktongemeinschaften veränderten und wohin Kohlenstoffpartikel im Wassersäulenprofil gelangten.

Roboterfloats liefern kontinuierlich detaillierte Daten zu Ozeanbedingungen. In dieser Studie analysierten Forschende des GO-BGC Projekts (Global Ocean Biogeochemistry Array) Daten aus im Golf von Alaska eingesetzten BGC-Argo-Floats sowie Aufzeichnungen aus schiffsbasierten Planktonuntersuchungen. Die Ergebnisse zeigen, wie Meeres-Hitzewellen Nahrungsnetze umformen und die Fähigkeit des Ozeans beeinträchtigen, atmosphärisches CO2 zu speichern.
Dieser Artikel fasst Methoden, zentrale Ergebnisse und die Bedeutung der Studie für Klimapufferung, marine Ökosysteme und die Zukunft der Ozeanbeobachtung zusammen. Er erläutert, warum kontinuierliche, koordinierte Messprogramme essenziell sind, da Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen erhöht.
Warum die biologische Kohlenstoffpumpe so wichtig ist
Der Ozean ist eine der wichtigsten globalen Kohlenstoffsenken; etwa ein Viertel der menschengemachten CO2-Emissionen wird von der Meeresoberfläche aufgenommen. Ein zentrales Langzeitspeicherverfahren ist die so genannte biologische Kohlenstoffpumpe. Phytoplankton nutzt Sonnenlicht und CO2, um organische Substanz zu bilden. Diese Biomasse gelangt durch Nahrungsnetze weiter, wird zu Partikeln aggregiert oder als Fäkalpellets wieder abgegeben und sinkt in tiefere Schichten der Wassersäule. Je tiefer Kohlenstoff gelangt, desto länger bleibt er aus dem atmosphärischen Kreislauf entfernt — von Jahrhunderten bis zu Jahrtausenden.
Meeres-Hitzewellen sind anomale Erwärmungen, die Tage bis Monate anhalten können. Solche Ereignisse verändern Artenzusammensetzung, Stoffwechselraten und trophische Wechselwirkungen. Das kann die Größe, Dichte und Sinkgeschwindigkeit der Partikel verändern oder die Verweildauer organischer Substanz in der Oberflächenzone erhöhen. Beides führt potenziell zu weniger Export von organischem Kohlenstoff in die Tiefsee. Um diese Prozesse zu verstehen, sind wiederholte, hochauflösende biologische und chemische Beobachtungen über die gesamte Wassersäule und über längere Zeiträume notwendig.
Studienaufbau und Beobachtungswerkzeuge
Die Forschung vereinte mehrere unabhängige Datensätze aus mehr als einem Jahrzehnt im Golf von Alaska, einer Region, die von zwei großen Meeres-Hitzewellen betroffen war: der 2013–2015 Hitzewelle bekannt als The Blob und einem starken Ereignis 2019–2020. Wichtige Beobachtungsinstrumente und Datentypen waren:
- GO-BGC BGC-Argo-Floats: Teil des Global Ocean Biogeochemistry Arrays, diese autonomen Floats maßen periodisch Temperatur, Salinität, Sauerstoff, Nitrat, Chlorophyllfluoreszenz und partikulären organischen Kohlenstoff. Mit Profilen alle 5–10 Tage lieferten sie hochfrequente Messreihen durch die obere Wassersäule, über Saisons und Störungen hinweg.
- Line P Schifferhebungen: Das langjährige Line P Programm von Fisheries and Oceans Canada lieferte saisonale Daten zur Planktonzusammensetzung mittels Pigmentchemie und Umwelt-DNA. Solche schiffsbasierten Stichproben bieten taxonomische Details und validieren Signale aus Floats.
- Interdisziplinäre Synthese: Forschende aus MBARI, University of Miami Rosenstiel School, Hakai Institute, Xiamen University, University of British Columbia, University of Southern Denmark und Fisheries and Oceans Canada kombinierten Expertise aus Ozeanographie, Molekularbiologie, Biogeochemie und Ökosystemwissenschaften.
Die Kombination autonomer und schiffbasierter Methoden erlaubte es, Veränderungen vor, während und nach Hitzewellen zu erfassen und kausale Zusammenhänge zwischen physikalischen Ereignissen und biologischen Antworten zu analysieren.
Wichtigste Entdeckungen: Wenn das Förderband klemmt
Die Studie fand konsistente Hinweise darauf, dass Meeres-Hitzewellen Planktongemeinschaften veränderten und den Kohlenstoffexport störten. Auffällig war jedoch, dass die beiden Hitzewellen unterschiedliche Mechanismen aufwiesen:
- 2013–2015 The Blob: Die Photosyntheseleistung an der Oberfläche nahm im zweiten Jahr zu, aber der partikuläre organische Kohlenstoff sammelte sich in etwa 200 Metern Tiefe an, anstatt schnell in abyssale Tiefen zu sinken. Das deutet auf einen Engpass in der Mesopelagialzone hin, wo kleine Partikel und recycelter Kohlenstoff zurückgehalten wurden.
- 2019–2020 Ereignis: Im ersten Jahr gab es rekordhohe Anhäufungen oberflächlicher Kohlenstoffpartikel, die nicht allein durch phytoplanktische Produktion erklärbar waren. Stattdessen schien verstärktes Recycling über das Nahrungsnetz und die Anhäufung von Detritus eine Rolle gespielt zu haben. Das Material begann zu sinken, stoppte aber meist zwischen 200 und 400 Metern und wurde nicht effizient in die Tiefsee überführt.
Bei beiden Ereignissen zeigte sich allgemein eine erhöhte Retention und Wiederverwertung organischen Kohlenstoffs in Oberfläche und Dämmerungszone. Treibende Faktoren waren ein Wechsel zu kleineren Phytoplanktonarten und eine höhere Dichte kleinerer Herbivoren. Kleine Herbivoren produzieren langsam sinkende Fäkalpellets und fördern mikrobielle Zersetzung, wodurch mehr Kohlenstoff in der Oberflächenzone verbleibt und das Risiko steigt, dass er wieder in die Atmosphäre gelangt.
Lead-Autorin Mariana Bif, vormals bei MBARI und jetzt Assistenzprofessorin an der University of Miami Rosenstiel School, fasst es so zusammen: Die beiden großen Meeres-Hitzewellen veränderten die Planktongemeinschaften und setzten die biologische Kohlenstoffpumpe unter Druck. Das Förderband, das Kohlenstoff von der Oberfläche in die Tiefsee transportiert, hat gestockt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kohlenstoff in die Atmosphäre zurückkehrt statt dauerhaft im Ozean gespeichert zu bleiben.
Mechanismen: Warum Partikelgröße und Mesopelagial wichtig sind
Die biologischen Prozesse, die Wärmeeinträge mit Kohlenstoffretention verknüpfen, lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen:
- Artenwechsel: Wärmere Bedingungen bevorzugen oft kleinere, warmwasseradaptierte Phytoplanktonlinien, die feine, langsam sinkende Partikel erzeugen anstelle großer Aggregate.
- Umschichtung des Nahrungsnetzes: Eine Zunahme kleiner Weideorganismen führt zu intensivem Recycling; Mikroorganismen atmen organischen Kohlenstoff als CO2 zurück, bevor er tiefer sinken kann.
- Mesopelagiale Verarbeitung: Die Dämmerungszone ist reich an Organismen, die sinkende Partikel konsumieren. Eine verringerte Sinkgeschwindigkeit verlängert die Verweilzeit der Partikel in dieser Zone und erhöht damit die Chance der Remineralisierung.
Kombiniert reduzieren diese Prozesse den Anteil des an der Oberfläche produzierten organischen Kohlenstoffs, der die Tiefsee erreicht. Für die Klimadynamik bedeutet dies eine Abschwächung des langfristigen Kohlenstoffsinks.
Welche Folgen hat das für Klima, Ökosysteme und Fischerei
Wenn Meeres-Hitzewellen häufiger und intensiver werden, wie Klimamodelle und Beobachtungsdaten nahelegen, könnte die Effizienz des Ozeans als Kohlenstoffsenke zurückgehen. Eine geringere Kohlenstoffbindung würde einen positiven Rückkopplungseffekt erzeugen: Mehr CO2 in der Atmosphäre beschleunigt die Erwärmung, was wiederum die Wahrscheinlichkeit und Stärke von Hitzewellen erhöht.
Die Auswirkungen reichen weit über den Kohlenstoffkreislauf hinaus. Veränderungen an der Planktonbasis wirken sich über trophische Ebenen aus und können Rekrutierung, Nahrungsgrundlage für Meeressäuger und die Produktivität kommerzieller Fischbestände beeinflussen. Regionale Küstenökonomien, die auf stabilen Fischereierträgen beruhen, könnten größere Schwankungen erleben, wenn die Nahrungskette zugunsten kleinerer, weniger nahrhafter Organismen verschoben wird.
Kurz gefragt: Was passiert mit dem Fischfang, wenn die Basis der Nahrungskette schrumpft oder sich qualitativ verändert? Die Antwort ist komplex und regional verschieden, doch das Risiko für geringere Erträge und unvorhersehbare Populationsdynamiken steigt.
Technologie, Monitoring und künftige Forschungsfelder
Die Studie demonstriert klar den Wert der Kombination autonomer BGC-Argo-Floats mit schiffsbasierten biologischen Erhebungen und molekularen Methoden wie eDNA und Pigmentanalysen. Daraus ergeben sich konkrete Prioritäten für die Forschung und Beobachtung:
- Flächendeckung ausbauen: Mehr BGC-Argo-Floats in unterschiedlichen Ozeanregionen sind nötig, um verschiedene Klimaregime und Hitzewellenereignisse zu erfassen.
- Vorher-nachher-Daten: Integrierte, institutionsübergreifende Beobachtungsnetzwerke sollten Systeme bereitstellen, die Ereignisse vor, während und nach Extremereignissen dokumentieren.
- Modelle verbessern: Biogeochemische und Ökosystemmodelle müssen Planktongemeinschaftsverschiebungen, Partikelbildung und mesopelagiale Prozesse besser darstellen, damit Prognosen zum Kohlenstoffexport unter zukünftiger Erwärmung zuverlässiger werden.
Ken Johnson, Senior Scientist bei MBARI und leitender Principal Investigator des GO-BGC Projekts, betonte die Bedeutung kollaborativer Ansätze. Um zu verstehen, wie Hitzewellen marine Ökosysteme verändern, brauchen Forscherinnen und Forscher Beobachtungsdaten, die zeitlich vor, während und nach den Ereignissen verfügbar sind. Nur so lassen sich Schlüsselfragen zur Gesundheit der Ozeane beantworten.
Was Beobachter und Modellierer jetzt tun sollten
Praktisch bedeutet das: Priorisierung von Langzeitmessstationen, Ausbau automatischer Sensorflotten, standardisierte Protokolle für eDNA-Analysen und engere Integration zwischen Datengebern. Modellierer sollten variable Partikelgrößenverteilungen sowie veränderte Weidepfade in Prognosemodelle implementieren, um Unsicherheiten in Klimavorhersagen zu reduzieren.
Fachliche Einordnung und Stimmen aus der Forschung
Dr. Lena Morita, Ozeanbiogeochemikerin, kommentierte die Studie: Die Ergebnisse sind ein klares Signal dafür, dass biologische Reaktionen auf Erwärmung das Schicksal von Kohlenstoff über Jahrzehnte verändern können. Autonome Floats liefern die zeitliche Auflösung, die nötig ist, um diese Reaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Für Modellierer ist es essenziell, dynamische Partikelgrößen und veränderte Weidepfade zu berücksichtigen, um Unsicherheiten zu verringern.
Solche Experteneinschätzungen unterstreichen, wie wichtig es ist, empirische Messungen mit modellgestützten Prognosen zu kombinieren, wenn politische Entscheidungen zur Klimaanpassung oder Fischereimanagement vorbereitet werden.
Förderung, Kooperationen und wissenschaftlicher Mehrwert
Die Forschung wurde hauptsächlich vom US National Science Foundation GO-BGC Projekt finanziert, mit zusätzlichen Mitteln von Stiftungen und internationalen Fördergebern. Zu den Unterstützern zählen unter anderem die David und Lucile Packard Foundation, China National Science Foundation und das Danish Center for Hadal Research. Solche koordinierten, internationale Investitionen in dauerhafte Ozeanbeobachtung liefern Erkenntnisse mit hohem gesellschaftlichem Mehrwert.
Die interdisziplinäre Autorenliste zeigt, wie koordinierte Forschung zwischen Ozeanographen, Molekularbiologen, Modellierern und regionalen Beobachtungsprogrammen Wissenschaft mit politischer und wirtschaftlicher Relevanz verbinden kann.
Am Ende steht die Erkenntnis, dass Meeres-Hitzewellen weit mehr sind als kurzfristige Temperaturanomalien. Sie greifen in fundamentale Ökosystemprozesse ein und verändern das Gleichgewicht zwischen atmosphärischem CO2 und seiner langfristigen Speicherung im Ozean.
Angesichts dieser Befunde ist die Ausweitung von Beobachtungsnetzen, die Integration moderner molekularer Werkzeuge und die Entwicklung besserer Modelle zentrale Schritte, um die Zukunft der Kohlenstoffsenke Ozean zu verstehen und mögliche Gegenmaßnahmen zu planen.
Quelle: sciencedaily

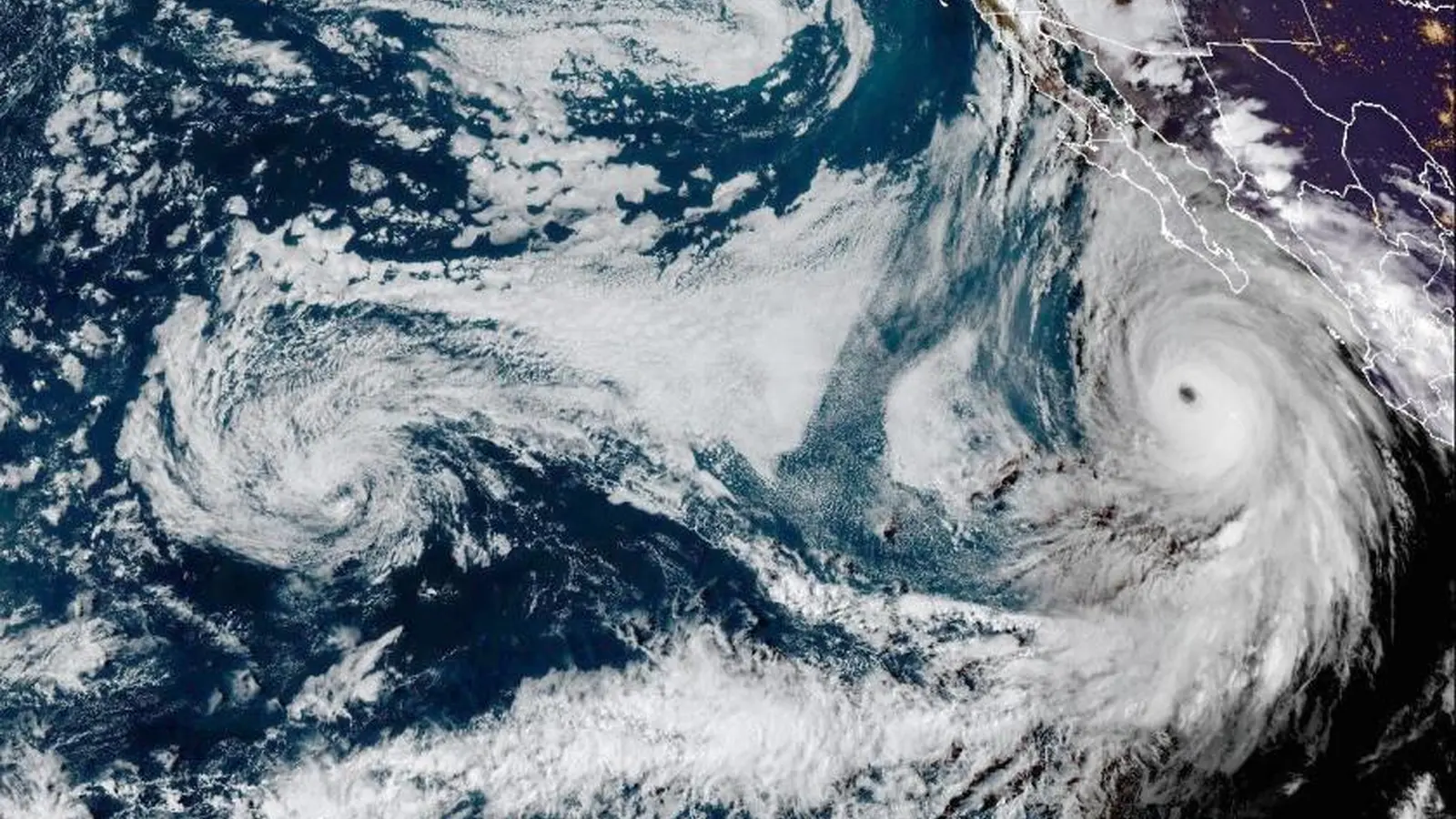
Kommentar hinterlassen