6 Minuten
Nickelreiche Einschlüsse in supertiefen Diamanten
Diamanten, die aus der Voorspoed-Mine in Südafrika geborgen wurden, enthalten sowohl Nickel-Eisen-Metalle als auch nickelreiche Karbonat-Einschlüsse, die eine Reihe von Reaktionen dokumentieren, welche sich in rund 300–470 km Tiefe unter der Erdoberfläche abgespielt haben. Ein Forscherteam unter der Leitung von Yael Kempe und Yaakov Weiss von der Hebrew University of Jerusalem identifizierte nano- bis mikrogroße metallische Legierungen sowie karbonatische Phasen, die innerhalb von Diamanten konserviert sind und offenbar in der tiefen oberen Mantelzone bis zur flachen Übergangszone (transition zone) gebildet wurden. Diese Beobachtung liefert neue, direkte Hinweise darauf, wie komplexe chemische Wechselwirkungen in großen Tiefen stattfinden und wie sie die Bildung, die chemische Zusammensetzung und schließlich den Aufstieg von magmatischen Produkten beeinflussen können. Die Entdeckung nickelreicher Legierungen in südafrikanischen Diamanten bestätigt langjährige theoretische Vorhersagen über stabilisierende Phasen im Mantel und zeigt, dass diese mikroskopischen Einschlüsse als Zeitkapseln dienen, die uns erlauben, Prozesse zu lesen, die sonst unerreichbar wären.
Wissenschaftlicher Hintergrund und Methoden
Der Erdmantel ist ein chemisch und physikalisch dynamischer Bereich: Er konvektiert, transportiert flüchtige Komponenten (Volatile) und tauscht Material mit der Kruste aus. Ein zentraler, aber schwer direkt messbarer Parameter ist der Redoxzustand des Mantels — also das Gleichgewicht zwischen oxidierten und reduzierten Spezies. Dieser Redoxzustand steuert die Stabilität von Mineralen, die Form, in der flüchtige Elemente wie Kohlenstoff und Wasser vorliegen, sowie die Zusammensetzung schmelzfähiger Phasen. In Laborversuchen unter hohen Drücken und Temperaturen sowie in thermodynamischen Modellen wurde bereits vor Jahrzehnten vorhergesagt, dass nickelreiche metallische Legierungen in einigen Mantelbedingungen stabil sein könnten, insbesondere in reduzierten, metallenreichen Umgebungen in einigen Hunderten Kilometern Tiefe. Allerdings fehlte bislang häufig direkter, natürlicher Nachweis dieser Phasen in Proben, die eindeutig aus vergleichbaren Tiefen stammen.
Weiss und Kollegen kombinierten modernste imaging- und Analytikmethoden, um diese winzigen Einschlüsse zu charakterisieren. Am Nanocenter der Hebrew University wurden hochauflösende Rasterelektronenmikroskopie (SEM), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), fokussierte Ionenstrahltechnik (FIB) für Präparationen sowie energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS) und Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) eingesetzt. Partnerlabore an der University of Nevada und der University of Cambridge ergänzten die Analysen mit massenspektrometrischen Untersuchungen, Isotopie-Messungen und Mikro-Raman-Spektroskopie. Drucksensible Einschlüsse wie Coesit (hochdruckstabile SiO2-Modifikation), kaliumreiche aluminosilikathaltige Phasen und molekulares Stickstoff (N2) wurden ebenfalls identifiziert; diese Phasen dienen als natürliche Tiefenindikatoren. Zusammengenommen beschränken diese Befunde die Bildungsbereiche der Diamanten auf etwa 280–470 km Tiefe und stützen damit eine Herkunft aus dem tiefen oberen Mantel oder der flachen Übergangszone. Solche Kombinationen von Mineralen und flüchtigen Komponenten ermöglichen eine robuste Rekonstruktion von Druck-, Temperatur- und Redoxbedingungen zur Zeit der Einschluss-Bildung.
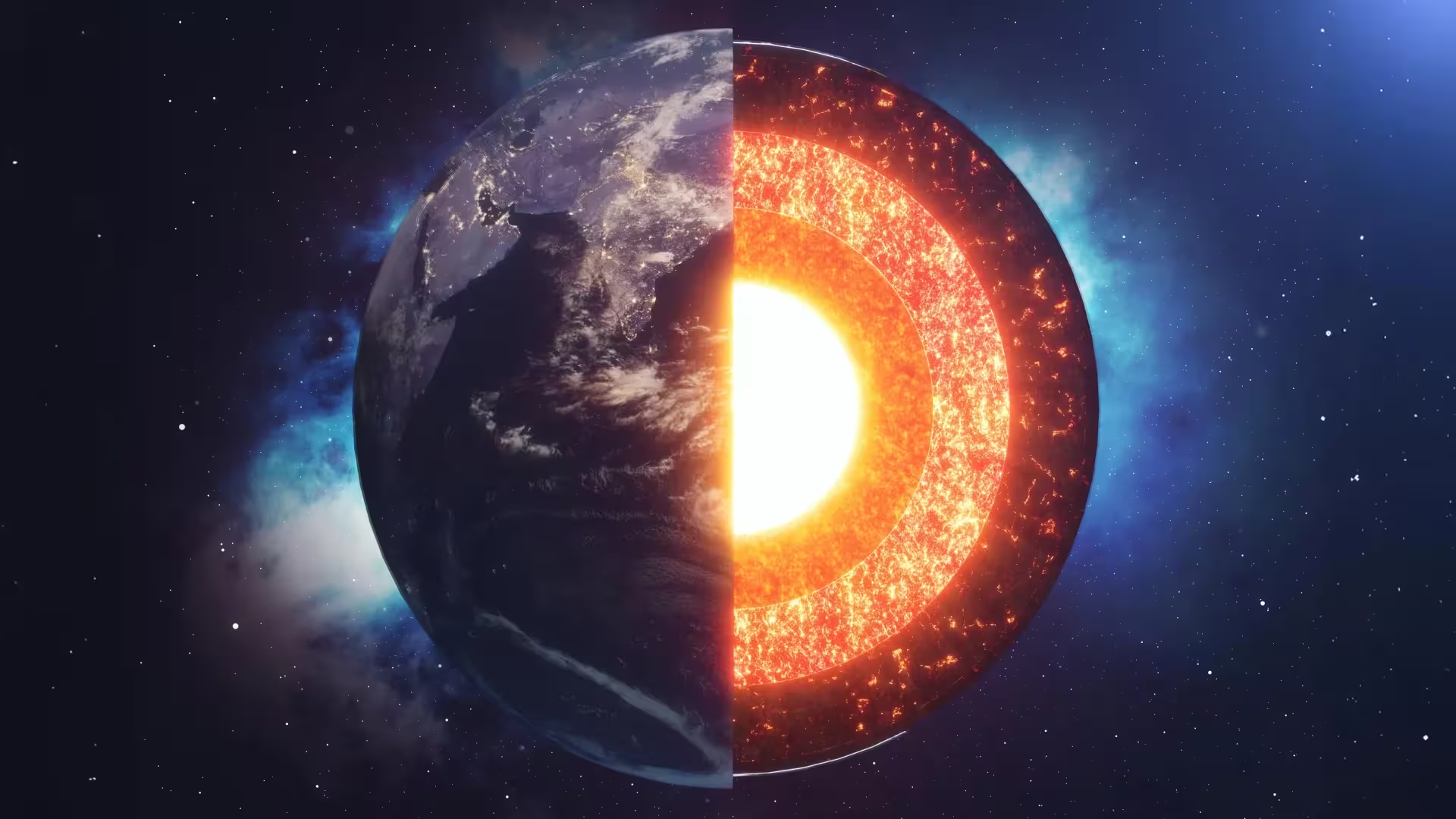
Schlüsselfund: Redox-Gefrieren und Reaktions-Schnappschüsse
Die beobachtete Koexistenz von Nickel-Eisen-Metall und nickelreichen Karbonaten innerhalb desselben Diamanten ist ein starkes Indiz für einen lokalisierten metasomatischen Prozess, der als Redox‑Freezing (Redox‑Gefrieren) beschrieben wird. In diesem Szenario infiltrierte eine oxidierte, karbonatitische bis silikatische Schmelze einen reduzierten, metalleinschichtigen Peridotit. Während dieses Kontaktsoxidierte sich Eisen relativ leicht und ging bevorzugt in die Schmelze über, wodurch das verbleibende metallische Phase zunehmend nickelreicher wurde. Parallel dazu konnten nickelreiche Karbonate aus der Schmelze auskristallisieren oder in situ durch Reduktion zu Diamant umgewandelt werden. Das Ergebnis sind winzige, aber mineralogisch und chemisch unterschiedliche Phasen, die nebeneinander erhalten blieben, weil die Diamanten sie schnell versiegelten und so ein weiteres chemisches Austauschgeschehen mit dem umgebenden Mantel verhinderte.
"Diese Diamanten fungieren wie mikroskopische Zeitkapseln", erläuterte Yaakov Weiss und betonte, dass sowohl Edukte als auch Produkte der Reaktion eingeschlossen wurden, bevor eine Re‑Equilibrierung mit dem umgebenden Mantelgestein erfolgen konnte. Die Identifizierung nickelreicher Legierungen in natürlichem Material stellt damit die erste empirische Bestätigung für die Stabilität solcher Phasen in den von Modellen vorhergesagten Manteltiefen dar. Dadurch werden nicht nur theoretische Annahmen über die Redox‑Verhältnisse des oberen Mantels validiert, sondern es entstehen auch konkrete Szenarien, wie flüssige Phasen den lokalen Redoxzustand verändern und so Mineralparagenesen innerhalb des Mantels determinieren können.
Folgen für Manteldynamik und Magmatismus
Die mikroskopischen Einschlüsse haben weitreichende Implikationen für unser Verständnis von Manteldynamik und magmatischen Prozessen. Lokalisierte Oxidationsereignisse infolge des Einbruchs oxidierter Schmelzen können kleine Manteldomänen schaffen, die reich an Flüchtigen und Karbonaten sind. Solche Bereiche haben eine herabgesetzte Schmelztemperatur und können bei relativ geringerer Temperatur Schmelzen erzeugen, die eine hohe Konzentration an CO2, H2O und anderen volatilen Bestandteilen enthalten. Diese volatile-reichen Schmelzen bilden geeignete Vorstufen für explosive, schnell aufsteigende Magmen wie Kimberlite und Lamprophyre, die bekannt dafür sind, Diamanten aus großen Tiefen rasch an die Erdoberfläche zu transportieren.
Das Vorhandensein nickelreicher metallischer Phasen deutet zudem auf heterogene Redoxbedingungen hin, die lokal stark davon abweichen können, was unter normalen Mantelverhältnissen erwartet wird. Solche Unterschiede erklären, warum manche supertiefe Diamanten Inklusionen mit vergleichsweise hohen Sauerstoff‑Aktivitäten (oxygen fugacity, fO2) aufzeichnen, während das umgebende Mantelmaterial als insgesamt reduzierter erscheint. Zusätzlich beeinflussen metasomatische Ereignisse die Verteilung inkompatibler Elemente (wie K, Rb, Ba), sowie seltener Erden und flüchtiger Kohlenstoffverbindungen — diese Veränderungen können isotopische Signaturen erzeugen, die bei der Herkunftsanalyse von Kimberliten und ähnlichen Magmen hilfreich sind. Insgesamt liefern die Befunde eine schlüssige Verknüpfung zwischen tiefen Redox‑Prozessen, lokalisierten metasomatischen Veränderungen und der Genese volatiler, diamanttragender Magmen.
Weiterreichende geochemische Verbindungen
Wenn metasomatische Oxidationsereignisse episodisch und räumlich begrenzt auftreten, lassen sich verschiedene beobachtete Phänomene erklären: Zum einen die Heterogenität der gemessenen Sauerstoff‑Aktivitäten in supertiefen Einschnitten, zum anderen die punktuelle Anreicherung von Kalium, Karbonaten und anderen inkompatiblen Elementen, die beim Eindringen oxidierter Schmelzen in Mantelgestein angereichert werden. Diese Elementanreicherungen können Manteldomänen vorbereiten, die bei späteren Ereignissen als keimfreiende Zonen für explosive, volatile‑reiche Eruptionen fungieren — etwa beim Entstehen von Kimberliten. Darüber hinaus haben solche Prozesse Konsequenzen für den globalen Kohlenstoffkreislauf, da Karbonate im Mantel als Kohlenstoffsenken fungieren und durch Redox‑Prozesse in gasförmige oder metallische Formen überführt werden können. Messmethoden wie Sauerstoff‑ und Kohlenstoffisotopie, sowie Spurenelement‑Analysen an den Einschlüsse selbst, helfen, diese komplexen Zusammenhänge quantitativ zu erfassen und in größere geodynamische Modelle einzufügen.
Schlussfolgerung
Die Voorspoed‑Diamanten liefern einen seltenen, direkten Befund tiefer Mantel‑Redoxreaktionen und bestätigen langjährige Vorhersagen zur Stabilität nickelreicher Legierungen in solchen Tiefen. Indem sie sowohl Metall‑ als auch Karbonatphasen bewahren, machen diese Diamanten deutlich, wie Schmelze‑Gesteins‑Interaktionen die Chemie des Mantels verändern und gleichzeitig volatile Reservoirs aufbauen, die später als Quelle für Kimberlite und andere volatile‑reiche Magmen dienen können. Als mineralische Zeitkapseln erlauben Diamanten damit nicht nur Rückschlüsse auf lokale physiko‑chemische Bedingungen, sondern geben auch Aufschluss über Prozesse, die entscheidend für die Verbindung von tiefen Mantelvorgängen mit Oberflächenphänomenen sind. Weitere systematische Untersuchungen ähnlicher Einschlüsse aus unterschiedlichen Lokalitäten und Tiefen könnten helfen, ein detaillierteres und quantitativeres Bild der räumlichen Verteilung von Redox‑Heterogenitäten im Mantel zu zeichnen und damit die Rolle solcher Prozesse im Kontext von Mantelkonvektion, Materialtransport und magmatischer Aktivität besser zu verstehen.
Quelle: sciencedaily


Kommentar hinterlassen