7 Minuten
Während die Lebenserwartung weltweit steigt, suchen Forschende intensiv nach alltäglichen Gewohnheiten, die das Denkvermögen bis ins hohe Alter erhalten. Neue, groß angelegte Befunde deuten darauf hin, dass das Beherrschen und aktive Nutzen von mehr als einer Sprache nicht nur Reisen und Kultur bereichert – es könnte auch bestimmte Aspekte der Gehirnalterung verlangsamen.
Warum Mehrsprachigkeit wie tägliches Gehirntraining wirken kann
Beim Wechseln zwischen Sprachen wählt das Gehirn ständig die passenden Wörter aus und unterdrückt gleichzeitig konkurrierende Alternativen. Dieses ständige Jonglieren geschieht nicht isoliert: Es fordert Aufmerksamkeit, Hemmung, Gedächtnis und die Fähigkeit zum Aufgabenwechsel – Funktionen, die zusammen als exekutive Kontrolle bezeichnet werden. Über Jahrzehnte hinweg kann diese wiederkehrende kognitive Arbeit neuronale Netzwerke stärken und das aufbauen, was Forschende als kognitive Reserve bezeichnen – die Fähigkeit des Gehirns, altersbedingte Veränderungen und Pathologien zu kompensieren, ohne dass sich Symptome zeigen.
Kurz gesagt: Eine Sprache aktiv auszuwählen und andere zurückzuhalten ist ein mentales Workout. Ähnlich wie bei körperlicher Bewegung addieren sich die Vorteile mit Häufigkeit und Intensität der Beanspruchung, sodass regelmäßige Sprachnutzung potenziell langfristige Effekte auf die kognitive Gesundheit haben kann.
Was die neue Studie ergab
In der Studie analysierten Forschende Daten von mehr als 86.000 gesunden Erwachsenen im Alter von 51 bis 90 Jahren aus 27 europäischen Ländern. Mithilfe eines Machine-Learning-Modells schätzten sie das scheinbare oder funktionelle Alter einer Person auf Basis mehrerer Indikatoren – Gedächtnisleistung, Alltagskompetenzen, Bildungsniveau, Mobilität sowie chronische Gesundheitsprobleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Hörverlust. Diese Methodik erlaubt eine integrierte Betrachtung von körperlichen, funktionellen und kognitiven Parametern, die für die Bestimmung des Gehirnalters relevant sind.

Die Differenz zwischen dem mittels Modell vorhergesagten Alter und dem tatsächlichen Lebensalter ergab eine Art „biobehavioralen Altersabstand“ („biobehavioural age gap“): Negative Werte weisen darauf hin, dass jemand jünger erscheint als sein chronologisches Alter; positive Werte deuten auf ein biologisch älteres Erscheinungsbild hin. Die Forscherinnen und Forscher korrelierten diese Lücke mit dem Ausmaß an Mehrsprachigkeit in den jeweiligen Ländern, gemessen am Anteil der Bevölkerung, der null, eine, zwei, drei oder mehr zusätzliche Sprachen spricht. Diese länderbezogene Messung von Sprachkontakt und Sprachvielfalt diente als Proxy für die alltägliche Exposition gegenüber Mehrsprachigkeit und sprachlicher Vielfalt.
Die Ergebnisse waren auffällig: Bewohnerinnen und Bewohner stark mehrsprachiger Länder – Beispiele sind Luxemburg, die Niederlande, Finnland und Malta – zeigten seltener eine beschleunigte Alterung in der zusammengesetzten Messung. Im Gegensatz dazu wirkten Menschen in überwiegend einsprachigen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Ungarn oder Rumänien biologisch älter. Bemerkenswert war, dass bereits das Beherrschen nur einer zusätzlichen Sprache einen messbaren Unterschied machte; das Sprechen mehrerer Sprachen zeigte einen stärkeren, dosisabhängigen Effekt. Diese Beobachtung unterstützt die Hypothese, dass Sprachvielfalt und häufige Sprachwechsel kognitive Reserve aufbauen können.
Wer profitiert am meisten?
Das schützende Muster war am deutlichsten bei Erwachsenen in ihren späten 70ern und 80ern zu beobachten. Für diese ältere Kohorte schien Bilingualismus oder Mehrsprachigkeit eine spürbare Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingten kognitiven Abbau zu verleihen. Die Forschenden kontrollierten für Dutzende nationaler Variablen – etwa Luftqualität, Migrationsbewegungen, Geschlechterungleichheit und politische Rahmenbedingungen – und der Mehrsprachigkeitsvorteil blieb bestehen. Das legt nahe, dass Sprachpraxis selbst einen eigenständigen Beitrag zur Gehirngesundheit leisten kann, unabhängig von anderen Landesmerkmalen.
Wie Sprachgebrauch das Gehirn verändern könnte
Die Studie selbst lieferte keine bildgebenden Befunde, doch andere Forschungsarbeiten bieten plausible Mechanismen. Das Management mehrerer Sprachen aktiviert frontale Netzwerke, die für Inhibition und Aufgabenwechsel zuständig sind, und scheint auch den Hippocampus zu beeinflussen – eine Struktur, die für die Bildung neuer Erinnerungen zentral ist. Einige Labore berichten über größere Hippocampus-Volumina bei lebenslangen Bilingualen, was bedeutsam ist, weil ein Volumenverlust des Hippocampus mit Gedächtniseinbußen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer in Verbindung gebracht wird. Solche strukturellen Unterschiede könnten durch anhaltende kognitive Belastung beim Sprachwechsel gefördert werden.
Wiederholte kognitive Beanspruchung durch häufiges Wechseln zwischen Sprachen könnte daher sowohl die strukturelle Integrität als auch die funktionelle Effizienz dieser Systeme verbessern – was wiederum zur kognitiven Reserve beiträgt und die Abnahmekurve langsamer verlaufen lässt. Neuroplastizität, synaptische Verstärkung und veränderte Konnektivitätsmuster sind Mechanismen, die in der Literatur diskutiert werden und die auch in größeren Querschnitts- und Längsschnittstudien messbar gemacht werden können.
Öffentliche Gesundheit, Politik und praktische Implikationen
Wenn Mehrsprachigkeit das alternde Gehirn tatsächlich schützt, hat das weitreichende Konsequenzen. Die Förderung von Sprachlernen und das Aufrechterhalten der Nutzung mehrerer Sprachen über die Lebensspanne könnten kostengünstige und kulturell anpassbare Strategien der öffentlichen Gesundheit darstellen, um kognitiven Abbau zu verzögern. Sprachreiche Umgebungen – Schulen, Gemeinschaften, Arbeitsplätze und Pflegeeinrichtungen – könnten als informelle kognitive Interventionen dienen, die neben körperlicher Aktivität und sozialer Teilhabe zur Prävention beitragen.
Praktische Maßnahmen könnten umfassen: niedrigschwellige Sprachkurse für ältere Erwachsene, mehrsprachige Programme in Schulen, Förderung bilingualer Arbeitsplätze und die Unterstützung intergenerationeller Sprachkontakte in Gemeinden. Solche Ansätze würden nicht nur die Sprachkompetenz stärken, sondern auch soziale Vernetzung und geistige Aktivität fördern, was wiederum positive Effekte auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden haben kann.
Dennoch sind bei der Übertragung in Politik und Praxis einige Einschränkungen zu beachten. Beobachtungsstudien können keine Kausalität nachweisen. Menschen, die mehrsprachig aufwachsen, unterscheiden sich oft systematisch in Bildung, sozialen Netzwerken und frühkindlichen Erfahrungen; obwohl die Studie viele länderspezifische Faktoren kontrollierte, können nicht erfasste individuelle Unterschiede weiterhin eine Rolle spielen. Zudem ist die maschinelle Schätzung des „vorhergesagten Alters“ ein zusammengesetztes Maß, das sich gut für Populationsanalysen eignet, aber keine klinische Diagnose für Einzelpersonen darstellt. Für evidenzbasierte Empfehlungen sind daher ergänzende Studiendesigns erforderlich, die individuelle Lebensläufe, sozioökonomische Faktoren und differenzierte Sprachnutzungsmuster erfassen.
Was Forschende als Nächstes planen
Zukünftige Arbeiten sollten Längsschnitt-Bildgebung des Gehirns mit detaillierten Messungen des Sprachgebrauchs kombinieren – nicht nur wie viele Sprachen jemand kennt, sondern wie häufig, in welchen Kontexten und mit welcher kognitiven Belastung gewechselt wird. Es ist wichtig, qualitative Aspekte der Sprachpraxis zu erfassen, etwa ob Sprachen regelmäßig im Beruf, in der Familie oder in sozialen Aktivitäten verwendet werden, sowie die Intensität und Komplexität des Sprachwechsels.
Randomisierte Interventionsstudien, in denen älteren Erwachsenen das Erlernen einer neuen Sprache vermittelt wird, könnten testen, ob das Erwerben einer zweiten Sprache im späteren Leben messbare kognitive oder neuronale Vorteile bringt. Solche Trials würden helfen, den Forschungsstand von rein korrelativen Befunden zu kausalen Handlungsempfehlungen weiterzuentwickeln. Ideal wären multimodale Studien, die Neuroimaging (z. B. MRT), neuropsychologische Tests, Alltagsfunktionalität und Biomarker kombinieren, um Mechanismen und langfristige Effekte abzubilden.
Expertinnen- und Experteneinschätzung
Dr. Maria Alvarez, Kognitionswissenschaftlerin am (fiktionalen) Centre for Lifespan Brain Health, kommentiert: „Die Idee, dass Sprachpraxis die Resilienz des Gehirns formt, ist überzeugend, weil sie eine alltägliche Tätigkeit mit messbaren neuralen Effekten verbindet. Selbst moderate Zuwächse an kognitiver Reserve in der Bevölkerung könnten erhebliche gesundheitspolitische Vorteile bedeuten – weniger Jahre mit Demenz, mehr Jahre mit Selbstständigkeit. Dennoch brauchen wir kontrollierte Interventionen, um zu verstehen, wie sich das Sprachenlernen im späteren Leben im Vergleich zu lebenslangem Bilingualismus auswirkt.“
Bis diese kontrollierten Befunde vorliegen, stützt die vorhandene Evidenz eine einfache Botschaft: Mehr als eine Sprache zu nutzen scheint ein kostengünstiges, hochwirksames Mittel zu sein, um den Geist aktiv zu halten. Ob durch formale Kurse, Konversationsgruppen oder den normalen Alltagsgebrauch – Sprachpraxis ist eine der zugänglichsten Methoden, um kognitive Reserven aufzubauen und zu erhalten. Sie ergänzt andere bewährte Maßnahmen wie körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung, soziale Teilhabe und kognitive Trainingsprogramme.
Quelle: sciencealert

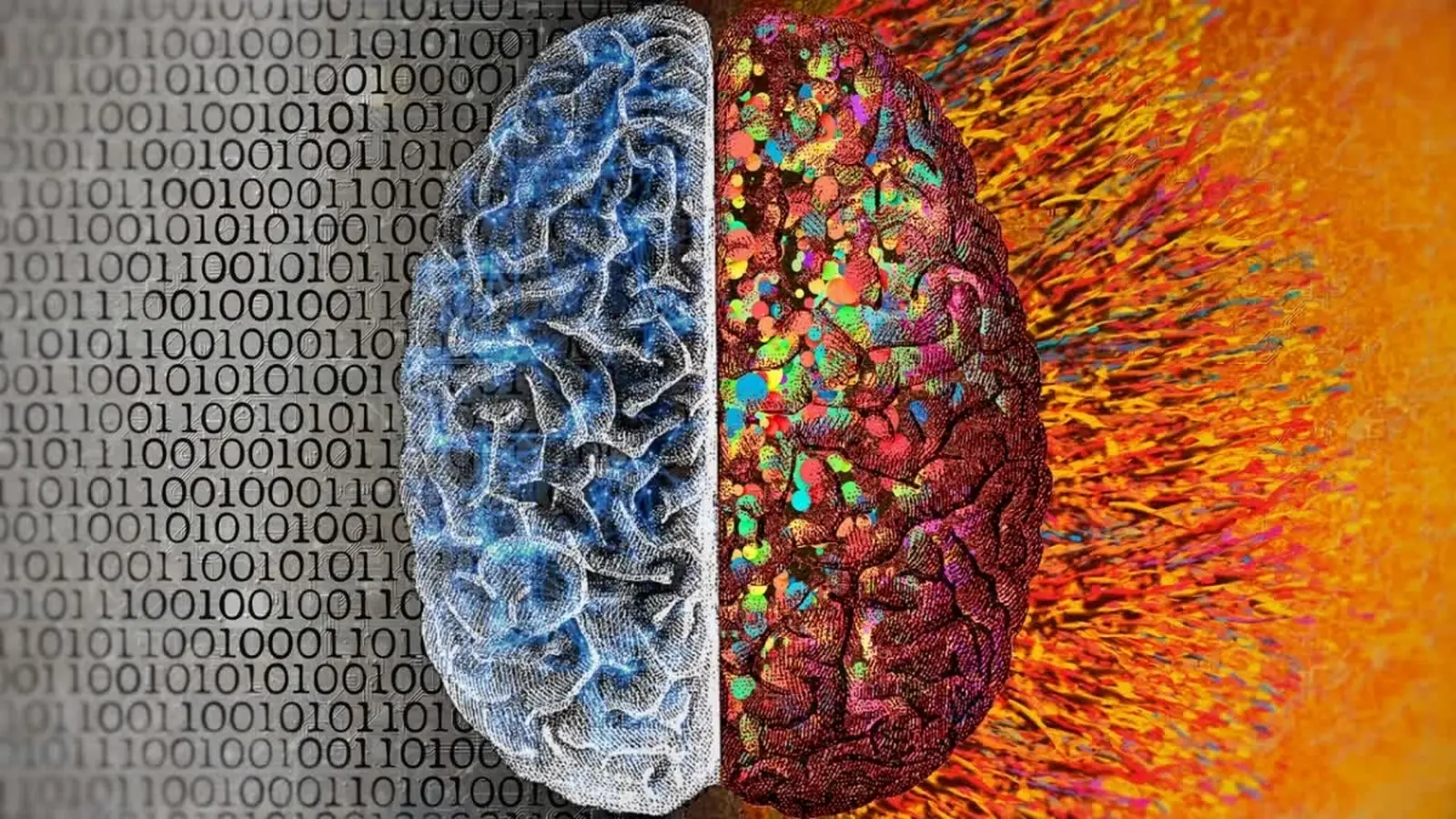
Kommentar hinterlassen