7 Minuten
Forscherinnen und Forscher des Francis Crick Institute und von Vividion Therapeutics haben einen neuartigen Wirkstoffkandidaten in die erste klinische Studie am Menschen überführt – einen Kandidaten, der ein zentrales krebsförderndes Signal gezielt blockiert, ohne die normalen Zellfunktionen weitgehend zu beeinträchtigen. Der Ansatz zielt auf die Wechselwirkung zwischen RAS, einem häufigen onkogenen Treiber, und dem Enzym PI3K ab und eröffnet eine mögliche Strategie zur Behandlung einer breiten Palette von RAS- und HER2-getriebenen Tumoren.
Ein gezielter Schlag gegen ein hartnäckiges Krebs-Signal
Mutationen in der RAS-Genfamilie führen in etwa einer von fünf Krebserkrankungen dazu, dass das RAS-Protein in einem dauerhaft aktiven Zustand verbleibt. Dieses konstante ‚An‘-Signal treibt unkontrollierte Zellteilung und Tumorwachstum voran. Das therapeutische Ausschalten RAS-gesteuerter Signalwege ist historisch schwierig gewesen, weil dieselben Signalwege für die normale Physiologie unverzichtbar sind. Unspezifische Hemmstoffe können daher erhebliche Nebenwirkungen verursachen – ein bekanntes Beispiel ist die Hemmung von PI3K, die das Insulinsignal stört und zu erhöhten Blutzuckerwerten führen kann.
Statt PI3K komplett zu blockieren, suchten die Teams von Vividion und dem Francis Crick Institute nach Molekülen, die spezifisch verhindern, dass PI3K mit RAS interagiert, während andere Funktionen von PI3K erhalten bleiben. Mithilfe groß angelegter chemischer Screenings und eines eigens am Crick entwickelten biologischen Assays identifizierten die Forschenden kleine Verbindungen, die in der Nähe der RAS-Bindungsoberfläche von PI3K binden und diese spezifische Schnittstelle irreversibel oder hochaffin blockieren. Dieser präzise Wirkmechanismus unterscheidet sich grundlegend von klassischen Enzym-Hemmstoffen und zielt auf die Proteinzusammenkunft – also auf eine Protein–Protein-Interaktion – ab.
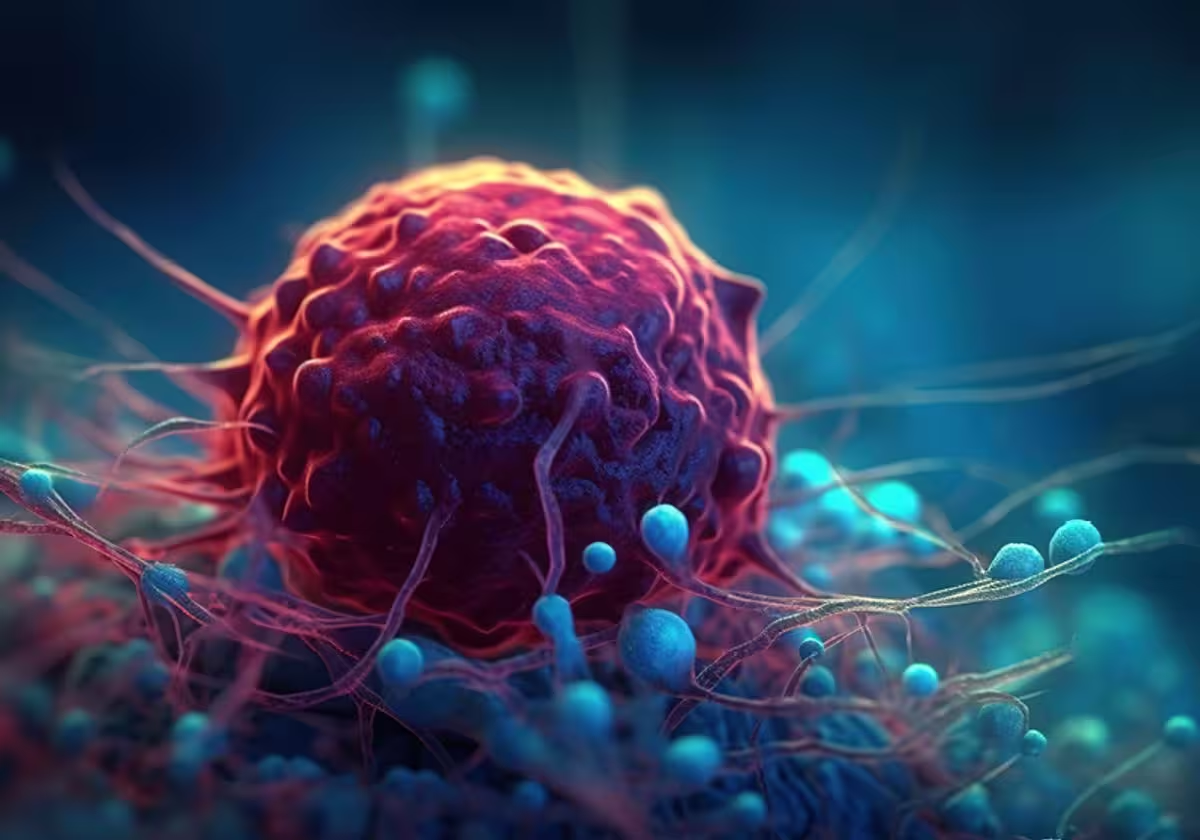
Von Molekülen zu Mäusen: Nachweis in präklinischen Studien
Nachdem ein aussichtsreicher Molekülkandidat ausgefiltert worden war, prüften die Teams die Substanz in verschiedenen Mausmodellen mit RAS-mutierten Lungenkarzinomen. In diesen präklinischen Versuchen führten Behandlungen zu einem deutlichen Stillstand des Tumorwachstums, ohne messbare Störungen der Blutglukose – ein wichtiges Sicherheitszeichen, das darauf hindeutet, dass die insulinabhängige PI3K-Aktivität weitgehend erhalten bleibt.
Die präklinischen Studien umfassten mehrere Modelltypen: xenotransplantate von menschlichen Tumoren, genetisch veränderte Mausmodelle mit endogenen RAS-Mutationen sowie orthotop implantierte Tumoren, um unterschiedliche biologische Kontexte abzubilden. Zusätzlich zur Monotherapie wurde der Kandidat in Kombination mit weiteren Inhibitoren getestet, die an anderen Stellen der RAS-Signalachse ansetzen (zum Beispiel MEK- oder ERK-Blocker in präklinischen Settings). Die Kombinationstherapien zeigten tiefere und länger anhaltende Tumorunterdrückung als Einzelwirkstoffe. Diese Befunde deuten auf eine klinisch relevante Strategie hin: die Kombination des RAS–PI3K-Blockers mit komplementären Wirkstoffen, um Resistenzmechanismen zu umgehen und die Therapieantworten zu verlängern.
Die präklinische Sicherheitsbewertung umfasste neben metabolischen Parametern auch Histopathologie, hämatologische Profile und Organfunktionen, um frühe Toxizitätszeichen zu erfassen. Pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Analysen zeigten in Tiermodellen eine Beziehung zwischen Dosis, Zielbedeckung und biologischer Wirkung, was die Dosisfindung für die erste-in-Mensch-Studie unterstützte.
Größeres Potenzial: Aktivität über RAS-mutante Tumoren hinaus
Erwartungsgemäß zeigte der Kandidat Wirksamkeit in RAS-getriebenen Tumoren. Überraschenderweise observierten die Forschenden jedoch auch Aktivität in Mausmodellen, deren Tumorwachstum durch HER2-Überexpression angetrieben wurde – ein Onkogen, das vor allem in Brustkrebs eine große Rolle spielt. HER2 kann PI3K rekrutieren, und die Störung der PI3K–Schnittstelle reduzierte das Tumorwachstum, selbst wenn RAS nicht die treibende Kraft war. Dieses unerwartete Ergebnis legt nahe, dass dieselbe chemische Strategie in mehreren Tumortypen wirksam sein könnte, die auf PI3K-Rekrutierung angewiesen sind, und nicht ausschließlich in solchen mit kanonischen RAS-Mutationen.
Die Beobachtung erweitert die potenzielle Indikationsbreite vom klassischen KRAS- oder NRAS-getriebenen Karzinom hin zu Tumoren mit alternativen PI3K-aktivierenden Mechanismen – dazu zählen HER2-positive Brustkrebssubtypen, bestimmte gastrointestinale Tumoren und andere Entitäten mit Überaktivierung des PI3K-Signalwegs. Solche Hinweise zur Indikationserweiterung müssen jedoch durch biomarkergetriebene klinische Studien validiert werden, die geeignete prädiktive Marker und Endpunkte einschließen.
Warum das wichtig ist: Präzision ohne Kollateralschaden
Das Besondere an diesem Ansatz ist der Fokus auf eine spezifische Protein–Protein-Interaktion statt auf die direkte enzymatische Hemmung der PI3K-Aktivität. Durch das selektive Unterbrechen des PI3K–RAS-Kontakts soll ein onkogenes Signal ausgeschaltet werden, während verbleibende PI3K-Funktionen für normale zelluläre Aufgaben – etwa die Insulinantwort – erhalten bleiben. Bewahrt sich diese Selektivität in klinischen Studien, könnte die Therapie eine gezielte Behandlungsoption darstellen, die im Vergleich zu pan-PI3K-Inhibitoren eine geringere Toxizität aufweist.
Aus klinischer Sicht ist dies ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal: Weniger metabolische Nebenwirkungen wie Hyperglykämie, weniger immunologische Effekte und eine bessere Verträglichkeit würden die Eignung für Kombinationstherapien verbessern. Eine besser verträgliche Kombination eröffnet die Möglichkeit, multiple Knotenpunkte in der RAS-PI3K-Signalkaskade gleichzeitig anzugreifen, was die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass Tumorzellen durch Umgehungswege Resistenzen entwickeln.
Nächste Schritte: Klinische Studien und Kombinationsprüfungen
Der Wirkstoffkandidat befindet sich nun in einer First-in-Human-Studie, deren Ziele Sicherheit, Verträglichkeit sowie frühe Hinweise auf biologische Aktivität in Patientinnen und Patienten mit Tumoren, die RAS- oder HER2-Veränderungen tragen, sind. Das klinische Protokoll enthält mehrere Arme, die den neuen Wirkstoff sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Substanzen prüfen, die an unterschiedlichen Stellen der RAS-Signalkaskade ansetzen. Solche Kombinationen sind rationale Ansatzpunkte, um Synergien zu nutzen, das Auftreten von Resistenzmechanismen zu verzögern und die Tiefe sowie Dauer der Tumorantwort zu erhöhen.
Im Rahmen der klinischen Studie werden die Untersuchenden pharmakokinetische Parameter (z. B. Cmax, AUC), pharmakodynamische Marker (z. B. Zielbedeckung, Signalweg-Inhibition) und metabolische Marker wie Blutzucker und Insulinniveau überwachen, um das erwartete Sicherheitsprofil zu bestätigen. Biomarker-Analysen, inklusive Immunhistochemie, Sequenzierung und möglicherweise Liquid Biopsy-Ansätzen, sollen zeigen, ob der Wirkstoff in menschlichen Tumoren tatsächlich die Rekrutierung von PI3K durch RAS oder HER2 unterbindet.
Langfristig werden geeignete Endpunkte in späteren klinischen Phasen erforderlich sein, um Wirksamkeit, Progressionsfreiheit und Gesamtüberleben zu bestimmen. Ebenso wichtig sind Subgruppenanalysen, um festzustellen, welche genetischen oder molekularen Konstellationen prädiktiv für eine Antwort sind – dies ist zentral für die Entwicklung einer biomarkerbasierten, personalisierten Onkologie-Strategie.
Stimmen aus Labor und Klinik
Julian Downward, Leiter des Oncogene Biology Laboratory am Crick, beschrieb die Arbeit als lange ersehnte präzisionsorientierte Strategie: das Unterbrechen einer krebsfördernden Interaktion, ohne die gesunden Funktionen eines Enzyms zu deaktivieren. Matt Patricelli, Chief Scientific Officer bei Vividion, betonte, wie chemisches Design Moleküle ermöglicht habe, die physisch den RAS–PI3K-‚Handschlag‘ blockieren und gleichzeitig PI3K erlauben, mit nicht-onkogenen Partnern zu interagieren – ein Fortschritt, der klinische Tests überhaupt erst zuließ.
Expertinnen- und Experteneinschätzung
‚Die gezielte Ansprache spezifischer Proteinoberflächen ist in der Onkologie eine sich konsolidierende Strategie‘, erklärt Dr. Elena Marquez, eine translationale Onkologin (fiktional), die frühe Studien begutachtet. ‚Wenn diese Inhibitoren ihre Selektivität beim Menschen beibehalten können, könnten wir Kombinationstherapien sicherer gestalten und Tumore aus mehreren Richtungen angreifen – was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Krebszellen einfach einen einzigen blockierten Signalweg umgehen. Entscheidend wird sein, robuste Biomarker und geeignete Kombinationen zu identifizieren.‘
Worauf man achten sollte
- Sicherheitsdaten aus ersten Patienten, insbesondere jegliche metabolischen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Insulinsignal.
- Biomarker-Ergebnisse, die zeigen, ob das Medikament in humanen Tumoren tatsächlich die PI3K-Rekrutierung durch RAS oder HER2 blockiert.
- Ergebnisse aus Kombinationsarmen, die Synergien mit anderen RAS-Weg-Inhibitoren prüfen (zum Beispiel MEK-, ERK- oder andere Signalwegmodulatoren).
- Eine mögliche Ausweitung auf weitere Tumortypen, wenn biomarkergetriebene Ansprechraten in Indikations-Explorationskohorten beobachtet werden.
Durch die Konzentration auf eine einzelne molekulare Interaktion zielt diese Forschung darauf ab, jahrzehntelange biologische Erkenntnisse in eine Therapie zu übersetzen, die sowohl wirksam als auch gut verträglich ist. Die ersten Human-Daten werden richtungsweisend sein: Sie zeigen, ob die präzise Chemie aus dem Labor in einen echten klinischen Nutzen für Patientinnen und Patienten mündet und damit eine neue Behandlungsoption für Tumoren bietet, die historisch von RAS- oder PI3K-Signalen abhängig sind.
Quelle: scitechdaily

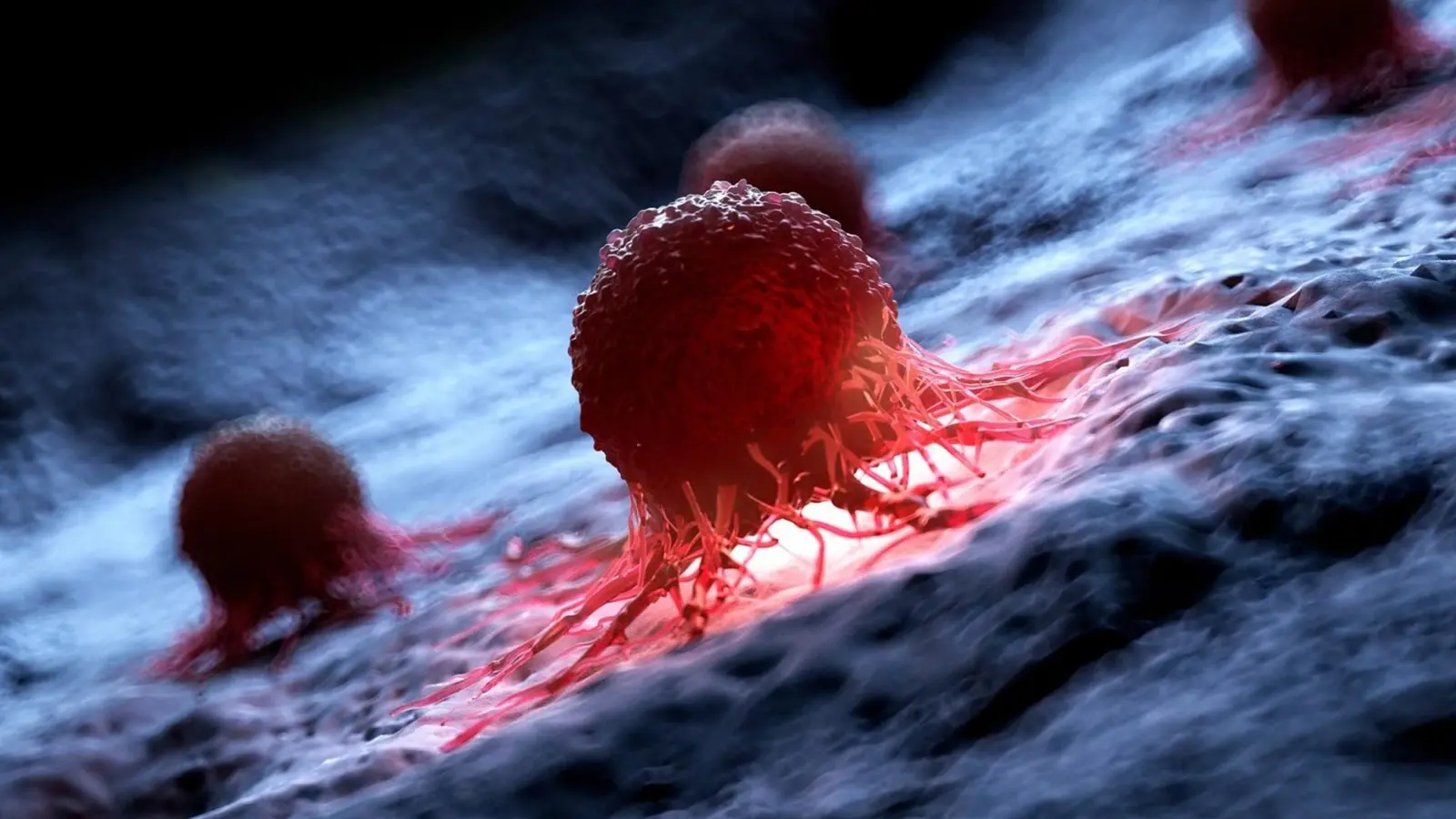
Kommentar hinterlassen