7 Minuten
Movement, not pills: reframing osteoarthritis care
Steife Knie, schmerzende Hüften und das reibende Unbehagen chronischer Gelenkerkrankungen gelten oft als unvermeidliche Folgen des Alterns. Doch neuere Evidenz und klinische Übersichtsarbeiten zeigen, dass unser Ansatz zur Prävention und Behandlung von Arthrose häufig nicht mit dem übereinstimmt, was tatsächlich wirkt. Die wirksamste und am leichtesten zugängliche Therapie für die meisten Menschen ist weder ein Medikament noch eine Operation, sondern strukturierte Bewegung: gezielte Übungstherapie und Physiotherapie. Diese Form der konservativen Behandlung — Bewegungstherapie, Physiotherapie, funktionelle Übungen — ist ein zentraler Bestandteil moderner Gelenkversorgung und sollte stärker in Versorgungswegen verankert werden.
In unterschiedlichen Gesundheitssystemen, von Irland und dem Vereinigten Königreich über Norwegen bis in die Vereinigten Staaten, erhalten weniger als die Hälfte der Patientinnen und Patienten mit Arthrose eine formelle Überweisung zu bewegungsbasierten Maßnahmen oder zur Physiotherapie durch ihren Hausarzt oder die primäre Versorgerin. Stattdessen werden viele Behandlungen verordnet, die klinische Leitlinien nicht empfehlen, und bis zu 40 % der Betroffenen werden zu chirurgischen Konsultationen überwiesen, bevor konservative Maßnahmen umfassend ausgeschöpft wurden. Das führt zu unnötigen Eingriffen, höheren Kosten und verpassten Chancen, Funktion und Lebensqualität durch gezielte Bewegung zu verbessern.
Why exercise protects joints: the biology in brief
Arthrose (Osteoarthritis) ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung, von der bereits Hunderte Millionen Menschen betroffen sind und deren Prävalenz bis zur Mitte dieses Jahrhunderts infolge demografischer Alterung, sitzender Lebensstile sowie steigender Übergewichts- und Adipositasraten erheblich zunehmen dürfte. Ein Verständnis der zellulären und gewebebiologischen Effekte von Bewegung erklärt, warum gezielte körperliche Aktivität so effektiv ist und wie Bewegungstherapien zur Gelenkgesundheit beitragen.
Knorpel — das elastische Gewebe, das Knochenenden polstert — besitzt keine direkte Blutversorgung. Er ist auf zyklische mechanische Belastung angewiesen, um Flüssigkeit, Nährstoffe und natürliche Schmierstoffe in und aus der Matrix zu bewegen, ähnlich wie das Ausdrücken und Entspannen eines Schwamms. Regelmäßige Bewegung fördert den Nährstoffaustausch und die Oberflächenintegrität des Knorpels; anhaltende Inaktivität reduziert den Flüssigkeitsaustausch und behindert Reparaturprozesse. Dadurch trägt Bewegung zur Aufrechterhaltung des Knorpelstoffwechsels und zur Verlangsamung degenerativer Veränderungen bei.
Arthrose betrifft jedoch nicht nur den Knorpel, sondern das gesamte Gelenkumfeld — Synovialflüssigkeit, subchondrales Knochengewebe, Bänder, die umgebenden Muskeln und die neuronalen Bahnen, die Bewegung steuern und Schmerz modulieren. Therapien, die mehrere dieser Elemente gleichzeitig ansprechen, sind deshalb besonders nützlich. Bewegung tut genau das: Sie stärkt die Muskulatur, die Gelenke stabilisiert, verbessert die neuromuskuläre Kontrolle und Koordination, reduziert zirkulierende proinflammatorische Faktoren und unterstützt gesündere Stoffwechselprofile. Solche systemischen Effekte erhöhen die Belastbarkeit des Gelenks und reduzieren Schmerzempfindungen.
Exercise modalities that work
Therapeutische Bewegung bei Arthrose umfasst Krafttraining (Widerstandstraining), aerobe Konditionierung, Mobilitäts- und Flexibilitätsübungen sowie neuromuskuläres Training, das Gleichgewicht und Bewegungsqualität fokussiert. Krafttraining baut Muskelmasse auf und verbessert die Gelenkstütze, während Ausdauertraining die kardiovaskuläre Gesundheit fördert und systemische Entzündungsparameter senkt. Flexibilitäts- und Mobilitätsübungen erhalten Bewegungsspielräume und reduzieren die Sturzgefahr, besonders bei älteren Menschen mit Kniearthrose oder Hüftarthrose.
Neuromuskuläre Programme wie GLA:D® (Good Life with osteoArthritis: Denmark) kombinieren betreute Gruppensitzungen unter der Leitung von Physiotherapeutinnen und -therapeuten mit patientenorientierter Aufklärung und praktischen Bewegungsübungen. Diese Programme legen Wert auf Bewegungsqualität, Balancetraining und schrittweise Belastungssteigerung, um Gelenkstabilität und Selbstvertrauen wiederherzustellen. Zahlreiche Studien dokumentieren klinisch relevante Schmerzreduktionen sowie Verbesserungen von Funktion und Lebensqualität, die bis zu einem Jahr nach Abschluss des Programms anhalten. Solche evidenzbasierten Programme sind ein Beispiel dafür, wie standardisierte Bewegungstherapie auf Bevölkerungsebene implementiert werden kann.

Osteoarthritis impacts the whole joint region
Mechanisms beyond mechanics: inflammation and metabolism
Adipositas erhöht das Arthrose-Risiko nicht nur durch zusätzliche mechanische Belastung der Gelenke, sondern auch durch eine Erhöhung entzündlicher Botenstoffe im Blut und in den Gelenkstrukturen. Diese Zytokine und adipokinen Mediatoren können den Knorpelabbau beschleunigen und die Schmerzsignalverarbeitung verändern. Regelmäßige körperliche Aktivität senkt proinflammatorische Marker, reduziert oxidativen Zelldamage und kann sogar die Genexpressionsmuster beeinflussen, die mit Gewebereparatur und Belastbarkeit assoziiert sind. Dadurch wirkt Bewegung nicht nur mechanisch, sondern auch biologisch-modulierend.
Da Bewegung systemische Vorteile bietet, spricht sie gleichzeitig Komorbiditäten an, die bei Menschen mit Arthrose häufig sind — zum Beispiel Typ‑2‑Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und depressive Störungen. Verbesserte metabolische Kontrolle, gesteigerte Insulinsensitivität und positive Effekte auf Stimmung und kognitive Funktionen sind zusätzliche gesundheitliche Gewinne, die Bewegungstherapie über die Gelenkgesundheit hinaus liefert. In klinischen Versorgungskonzepten ist es deshalb sinnvoll, Arthrose nicht isoliert zu behandeln, sondern im Kontext des gesamten Gesundheitszustands und der Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) zu sehen.
Clinical implications: try exercise before surgery
Derzeit gibt es kaum breit verfügbare, nachweislich krankheitsmodifizierende Medikamente für Arthrose. Gelenkersatzoperationen können bei fortgeschrittener Erkrankung die Lebensqualität vieler Patientinnen und Patienten dramatisch verbessern, sind jedoch große Eingriffe mit Risiken, langen Rehabilitationsphasen und variablen Langzeitergebnissen. Für den Großteil der Betroffenen empfehlen Leitlinien eine Stufentherapie, die mit konservativen Maßnahmen beginnt: strukturierte Bewegung, Gewichtsmanagement wenn relevant, Patientenaufklärung (Education) und gezielte Physiotherapie.
Bewegung sollte frühzeitig eingeführt, an die individuelle Leistungsfähigkeit angepasst und über alle Krankheitsstadien hinweg fortgeführt werden. Im Vergleich zu vielen pharmakologischen Optionen verursacht Bewegung deutlich weniger Nebenwirkungen und bringt darüber hinaus allgemeine Gesundheitsgewinne. Selbst bei Patientinnen und Patienten, die später eine Operation benötigen, können präoperative Übungsprogramme (prehabilitation) die postoperative Erholung und Funktion verbessern. Daher ist es klinisch und ökonomisch sinnvoll, Bewegungstherapie als erste therapeutische Stufe zu priorisieren.
Implementation barriers and opportunities
Warum wird Bewegung dann so selten verordnet? Hindernisse sind begrenzte Zeit in hausärztlichen Konsultationen, unzureichende Ausbildung von Klinikerinnen und Klinikern in der Verschreibung von Bewegung und Übungsprogrammen, die Überzeugung von Patientinnen und Patienten, Aktivität könnte Gelenkschäden verschlimmern, sowie ungleichmäßiger Zugang zu betreuter Physiotherapie. Diese Lücken erfordern eine bessere Aus‑ und Fortbildung von Fachkräften, systematische Patientenaufklärung, eine breitere Verfügbarkeit evidenzbasierter Gruppenkurse (wie GLA:D®) und politische Anreize, konservative Versorgungswege vor chirurgischen Optionen zu priorisieren.
Technologische Hilfsmittel — Wearables zur Messung von Bewegungsumfang und Belastung, Tele-Rehabilitationsplattformen, app-basierte Übungsmodule und sensorunterstützte Feedbacksysteme — erleichtern die Personalisierung der Belastungssteigerung und das Monitoring der Adhärenz. Solche digitalen Lösungen bieten skalierbare Möglichkeiten, hochwertige Bewegungstherapie für größere Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, insbesondere in ländlichen Regionen oder dort, wo direkte physiotherapeutische Betreuung begrenzt ist. Wichtig ist dabei, dass digitale Programme evidenzbasiert implementiert, datenschutzkonform gestaltet und klinisch begleitet werden.
Expert Insight
„Bewegung ist das am meisten unterschätzte Medikament bei Arthrose“, sagt Dr. Elena Morris, eine klinische Physiotherapeutin und Forscherin mit Schwerpunkt muskuloskelettale Rehabilitation. „Wenn wir Patientinnen und Patienten beibringen, sich effektiv zu bewegen, und progressives Widerstands‑ sowie Gleichgewichtstraining verschreiben, sehen wir nicht nur Schmerzreduktion, sondern konkrete Verbesserungen in Funktion und Selbstvertrauen. Die Herausforderung besteht darin, betreute, evidenzbasierte Programme zugänglich zu machen und sie in die Routinen der Primärversorgung zu integrieren.“
Conclusion
Arthrose ist nicht einfach unvermeidliches Verschleißen. Es handelt sich um eine multifaktorielle, das gesamte Gelenk betreffende Erkrankung, die von Muskelkraft, Entzündungszustand, metabolischem Profil und individueller Bewegungsgeschichte geprägt wird. Regelmäßige, gezielte Bewegung adressiert viele dieser Treiber gleichzeitig — sie nährt den Knorpel über mechanische Belastung, stellt muskuläre Unterstützung wieder her, verbessert neuromuskuläre Kontrolle und senkt systemische Entzündungswerte. Für die Mehrheit der Patientinnen und Patienten sollte bewegungsbasierte Therapie die Erstlinientherapie sein und über den gesamten Krankheitsverlauf fortgesetzt werden; eine Operation bleibt für Fälle vorbehalten, die auf umfassende konservative Behandlung nicht ansprechen. Damit Bewegung als Standardpraxis verankert werden kann, sind Ausbildung der Behandlerfachkräfte, fortlaufende Patienteninformation und ein breiterer Zugang zu betreuten Programmen notwendig. Die potenziellen Vorteile für einzelne Betroffene und für Gesundheitssysteme sind erheblich, sowohl in Bezug auf Lebensqualität als auch auf Kostenreduktion durch Vermeidung unnötiger Interventionen.
Quelle: sciencealert

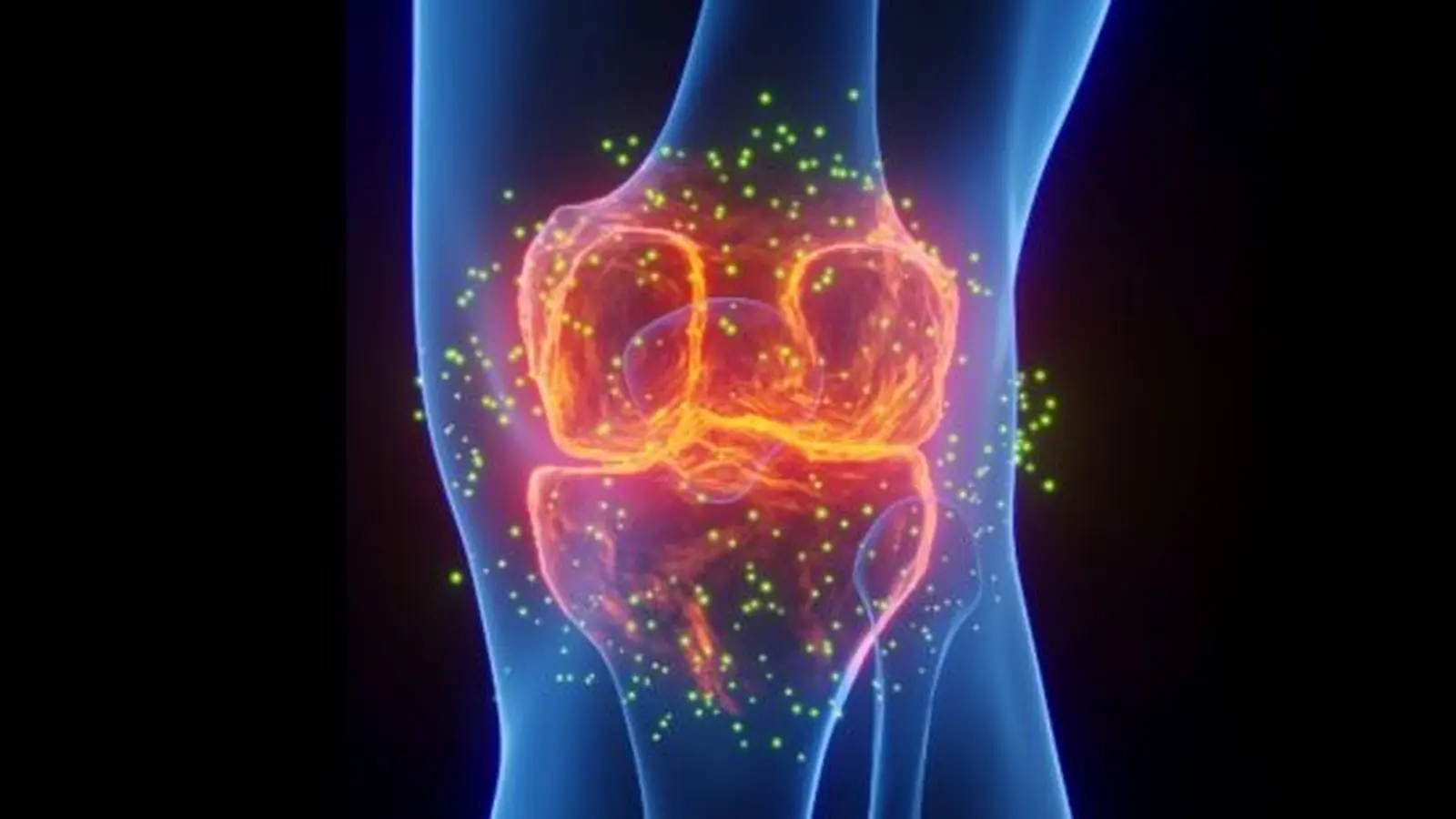
Kommentar hinterlassen