7 Minuten
Eine neue große Übersichtsarbeit in The BMJ hebt aerobes Training — Gehen, Radfahren, Schwimmen — als die wirkungsvollste Bewegungsstrategie hervor, um Schmerzen zu lindern und die Mobilität bei Menschen mit Kniearthrose wiederherzustellen. Im Folgenden finden Sie, was die Evidenz zeigt, wie sich verschiedene Trainingsformen vergleichen und welche praktischen Schlussfolgerungen sich für Patientinnen, Patienten und Behandelnde ergeben.
Die aktuelle BMJ-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass aerobe Übungen wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen die effektivste Strategie sind, um Schmerzen zu vermindern und die Beweglichkeit bei Patientinnen und Patienten mit Kniearthrose zu verbessern. Credit: Shutterstock
Warum das wichtig ist: Arthrose, Funktion und Alltag
Arthrose (Osteoarthritis) entsteht, wenn der schützende Knorpel, der die Knochen an den Gelenkflächen polstert, allmählich abnimmt. Dies führt zu Schmerzen, Schwellungen, Steifheit und eingeschränkter Beweglichkeit. Das Knie zählt zu den am häufigsten betroffenen Gelenken: Fast 30 % der Erwachsenen über 45 zeigen radiografische Zeichen einer Kniearthrose, und etwa die Hälfte dieser Personen berichtet über für sie relevante Symptome wie Schmerz und eingeschränkte Gehfähigkeit. Diese Einschränkungen wirken sich direkt auf Alltagsaktivitäten aus — Treppensteigen, längeres Gehen, Ein- und Aussteigen aus einem Auto oder das Aufstehen von einem Stuhl können belastend werden.
Weil Arthrose häufig ist und in ihrer Symptomatik progressiv verlaufen kann, ist es eine gesundheitspolitische Priorität, praktikable und risikoarme Interventionen zu identifizieren, die sowohl Schmerzen reduzieren als auch die funktionelle Leistungsfähigkeit erhalten oder verbessern. Bewegungstherapie, die in Gesundheitswesen und Rehabilitation seit Langem empfohlen wird, ist dabei ein zentrales Element. Innerhalb dieses Spektrums nehmen aerobe Aktivitäten, Krafttraining, Gleichgewichts- und Koordinationstraining sowie multimodale Programme unterschiedliche Rollen ein — die neue Übersichtsarbeit bietet eine umfassende Bewertung dieser Optionen.
Was die Übersichtsarbeit untersuchte: Umfang und Methoden
Die Forscherinnen und Forscher fassten Daten aus 217 randomisierten kontrollierten Studien (1990–2024) mit insgesamt 15.684 Teilnehmenden zusammen. Ziel war ein Vergleich von sechs Trainingskategorien: aerobes Training, Krafttraining (strengthening), Beweglichkeitsübungen, Mind-Body-Programme (z. B. Tai Chi, Yoga), neuromotorisches Training (Balance und Koordination) sowie gemischte Programme, die mehrere Komponenten kombinierten. Bewertet wurden primär Schmerzintensität und körperliche Funktion; sekundäre Endpunkte umfassten Geh- und Laufleistung (z. B. Gehgeschwindigkeit), sowie gesundheitsbezogene Lebensqualität.
Die Auswertung differenzierte nach Follow-up-Zeiträumen: kurzfristig (etwa 4 Wochen), mittelfristig (ca. 12 Wochen) und langfristig (rund 24 Wochen). Aufgrund unterschiedlicher Studiendesigns und -qualitäten wurden die Ergebnisse mit dem GRADE-System eingeordnet, sodass Leserinnen und Leser nicht nur Effekte, sondern auch die Zuverlässigkeit der Evidenz einschätzen können. Die Autorinnen und Autoren berichteten ferner über Nebenwirkungen, Abbruchraten und die Art der eingesetzten Interventionen, um praktische Hinweise zur Umsetzung abzuleiten.

Aerobes Training war führend — andere Ansätze bieten ergänzende Vorteile
Über alle untersuchten Outcomes und Zeitpunkte hinweg zeigte aerobes Training die höchste Wahrscheinlichkeit, die vorteilhafteste Therapieform zu sein. Die Evidenz mit moderater Sicherheit legt nahe, dass aerobe Aktivitäten kurzfristig und mittelfristig Schmerzen reduzieren, die körperliche Funktion kurzfristig, mittelfristig und langfristig verbessern und die Gehperformance sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität in kurzen und mittleren Zeiträumen positiv beeinflussen. Zu den typischen Formen des aeroben Trainings gehören zügiges Gehen, Fahrradergometer-Übungen (stationäres oder freies Radfahren) und Wassertraining / Aquajogging, die als gelenkschonend gelten.
Andere Trainingsformen lieferten gezielte Effekte: Mind-Body-Programme wie Tai Chi oder Yoga scheinen besonders deutlich kurzfristige Verbesserungen der funktionellen Leistung zu erzielen — dies kann mit Aspekten wie Körperwahrnehmung, rythmischer Bewegung und Atemsteuerung zusammenhängen. Neuromotorisches Training, also gezieltes Gleichgewichts- und Koordinationstraining, war besonders wirksam bei der kurzfristigen Verbesserung der Gehgeschwindigkeit und des Sturzrisiko-Profils. Kraft- oder kombinierte Programme schienen vor allem mittelfristig die Muskulatur und damit die Funktion zu verbessern. Insgesamt impliziert dies eine Priorisierung von aeroben Übungen, wenn das primäre Ziel Schmerzreduktion und verbesserte Alltagsfunktion ist; ergänzende Maßnahmen wie Kraft- oder Gleichgewichtstraining erhöhen jedoch die Gesamtwirkung und unterstützen Langzeiteffekte.
Sicherheit und Studienschwächen, die beachtet werden sollten
Wichtig ist: Keine der untersuchten Bewegungsinterventionen verzeichnete mehr unerwünschte Sicherheitsereignisse als die Kontrollgruppen. Dies stützt die Empfehlung, Bewegung als risikoarme Therapieoption einzusetzen. Dennoch weisen die Autorinnen und Autoren auf Einschränkungen hin, die die Interpretation einzelner Befunde relativieren. Viele Vergleichsdaten ergaben sich indirekt (Netzwerk-Meta-Analyse), was die Präzision einzelner Effektgrößen reduziert. Für einige Outcomes fehlen robuste Langzeitdaten, sodass Aussagen über Erhaltseffekte über mehrere Jahre limitiert sind. Kleinstudien-Effekte und Publikationsbias könnten kurzfristige Ergebnisse verzerren.
Darüber hinaus variierte die Qualität der Studien beträchtlich: Unterschiede in Interventionsdosis, Adhärenz, Beginnzeitpunkt und Begleittherapien erschweren direkte Vergleiche. Patientenmerkmale wie Übergewicht, Komorbiditäten (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes) oder das Ausmaß der strukturellen Arthroseveränderungen wurden unterschiedlich berücksichtigt. Klinisch sinnvoll ist daher ein vorsichtiges Abwägen der berichteten Effektstärken unter dem Gesichtspunkt der individuellen Situation und eine konsequente Anpassung der Übungen an Schmerz, Kondition und Begleiterkrankungen.
Wie sich diese Evidenz in der Praxis anwenden lässt
Für die Mehrheit der Patientinnen und Patienten mit Kniearthrose können strukturierte aerobe Aktivitäten — zügiges Gehen, stationäres Fahrradtraining oder wasserbasierte Übungen — als leicht zugängliche Erstlinienbehandlung dienen. Die folgenden Prinzipien helfen bei der Umsetzung:
- Schrittweiser Einstieg: Beginnen Sie mit kurzen, häufigen Einheiten (z. B. 10–15 Minuten) und steigern Sie zuerst die Dauer, dann die Intensität.
- Individuelle Anpassung: Passen Sie Frequenz, Intensität und Umfang an das Schmerzniveau und die körperliche Verfassung an. Nutzen Sie die schmerzbasierte Progression: eine moderate Schmerzsteigerung während des Trainings ist akzeptabel, anhaltende oder zunehmende Schmerzen hingegen ein Warnzeichen.
- Gelenkschonende Auswahl: Bei ausgeprägten Schmerzen sind niedrig belastende Aerobic-Optionen wie Radfahren oder Schwimmen empfehlenswert, da sie die Gelenkbelastung reduzieren und dennoch Ausdauer und Kreislauf stärken.
- Kombination mit Kraft- und Balance-Training: Ergänzendes Krafttraining, insbesondere für Quadrizeps und Hüftmuskulatur, verbessert die Gelenkstabilität und entlastet das Knie. Gleichgewichtsübungen reduzieren Sturzrisiken und unterstützen die Gangdynamik.
- Supervision und Anleitung: Physiotherapie, gelenkspezifische Reha-Programme oder betreute Trainingsgruppen erhöhen die Übungstreue (Adhärenz), verbessern die Ausführungsqualität und reduzieren das Verletzungsrisiko.
Wenn aerobes Training wegen schwerer Begleiterkrankungen, akutem Schmerzgeschehen oder funktionellen Einschränkungen nicht machbar ist, sind strukturierte Alternativen wie passives Beweglichkeitstraining, gezieltes Kraftaufbautraining unter Aufsicht oder individuell zugeschnittene Mind-Body-Programme immer noch mit relevanten Vorteilen verbunden.
Praktische Tipps für Patientinnen und Patienten
- Beginnen Sie mit kurzen, häufigen Einheiten (10–15 Minuten) und steigern Sie lieber die Dauer als sofort die Intensität. Regelmäßigkeit fördert nachhaltige Effekte.
- Wählen Sie bei Schmerzspitzen niedrig belastende aerobe Optionen wie Radfahren oder Schwimmen statt langem Gehen auf hartem Untergrund.
- Kombinieren Sie aerobe Arbeit mit gezieltem Krafttraining für Quadrizeps, Gesäß- und Hüftmuskulatur — dies stabilisiert das Knie und kann Schmerzen langfristig reduzieren.
- Suchen Sie betreute Programme, Physiotherapie oder spezifische Rehabilitationskurse auf, wenn Schmerz oder Mobilität den Einstieg erschweren; fachliche Anleitung verbessert Technik, Dosierung und Sicherheit.
- Behalten Sie Gewichtskontrolle und Gewichtsreduktion im Blick: Schon moderate Gewichtsabnahme entlastet das Knie mechanisch und kann die Wirksamkeit von Training erhöhen.
- Achten Sie auf passende Schuhwerk und geeignete Untergründe; bei Bedarf unterstützen orthopädische Einlagen oder Gehhilfen die Belastungsverteilung.
Expertinnen- und Experteneinschätzung
„Diese Übersichtsarbeit fasst Jahrzehnte klinischer Studien zu einer klaren Botschaft zusammen: Bewegen Sie sich weiter, mit Schwerpunkt auf aeroben Aktivitäten,“ sagt Dr. Laura Mendes, eine fiktive klinische Rheumatologin und Bewegungsforscherin. „Aerobes Training verbessert nicht nur subjektive Schmerzwerte, sondern auch reale Alltagsfunktionen — Gehgeschwindigkeit, Balance und Selbstständigkeit. Behandelnde sollten es wie jede andere evidenzbasierte Therapie verschreiben und individuell anpassen.“
Aus klinischer Sicht bedeutet das konkret: Aerobe Übungen sind eine sichere, kosteneffiziente und leicht skalierbare Intervention, die sich sowohl in der Primärversorgung als auch in spezialisierten Reha-Settings einsetzen lässt. Die Auswahl der konkret empfohlenen Aktivität sollte auf Patientenpräferenzen, körperlicher Belastbarkeit und Zugang zu Ressourcen (Schwimmbad, Fahrradergometer, Bewegungstherapeuten) basieren. Langfristiger Erfolg hängt von Regelmäßigkeit, realistischer Zielsetzung und oft auch von interdisziplinärer Begleitung (Ernährungsberatung bei Übergewicht, Schmerzmanagement, psychologische Unterstützung) ab.
Insgesamt stützt die Evidenz aerobe Aktivitäten als führende, sichere und praktikable Maßnahme zur Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung bei Kniearthrose. Leistungserbringer und Betroffene, die konsistente, anpassbare aerobe Programme priorisieren, werden wahrscheinlich messbare Verbesserungen in der alltäglichen Lebensführung erfahren. Ergänzende Strategien wie Kraftaufbau, Gleichgewichtstraining und Mind-Body-Methoden können die Effekte erweitern und die individuelle Therapie optimieren.
Quelle: scitechdaily

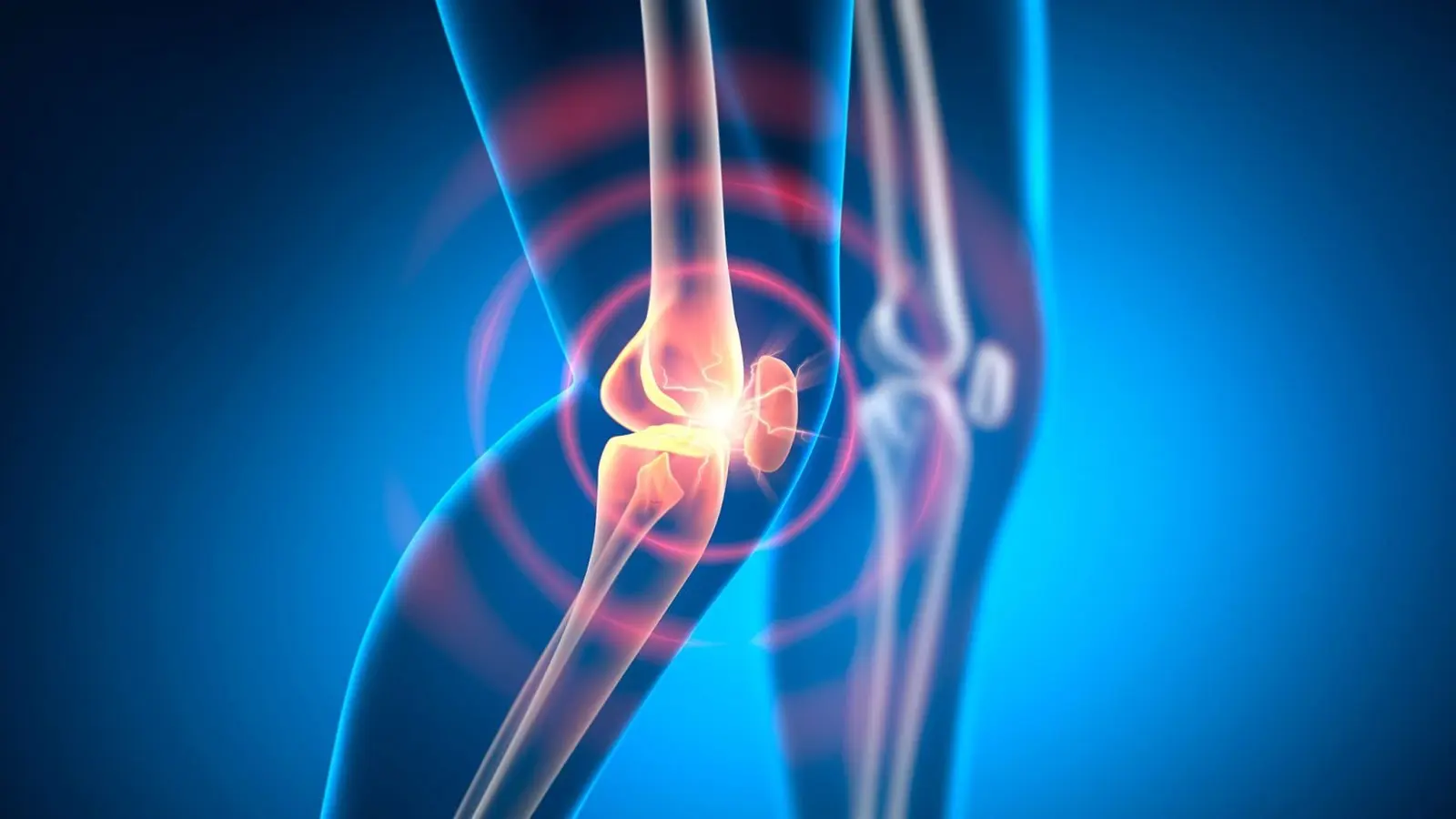
Kommentar hinterlassen